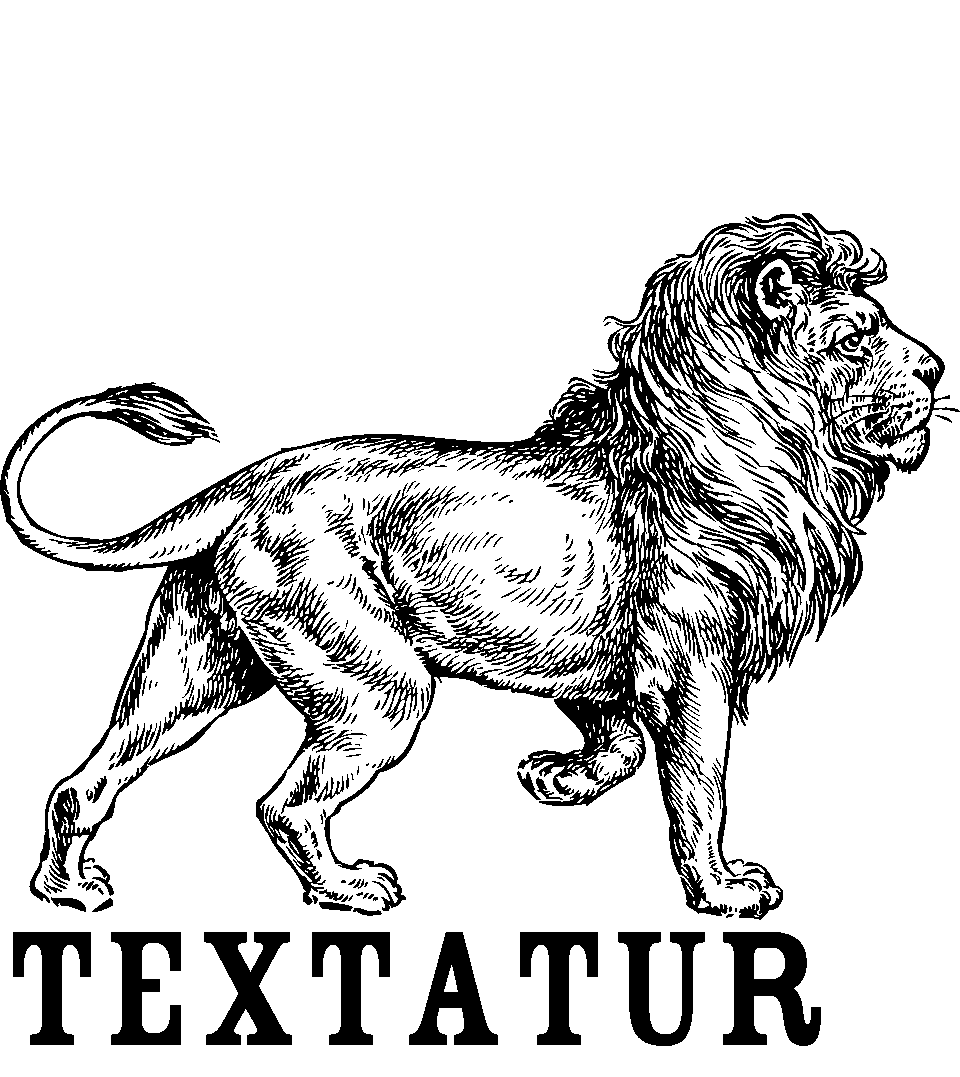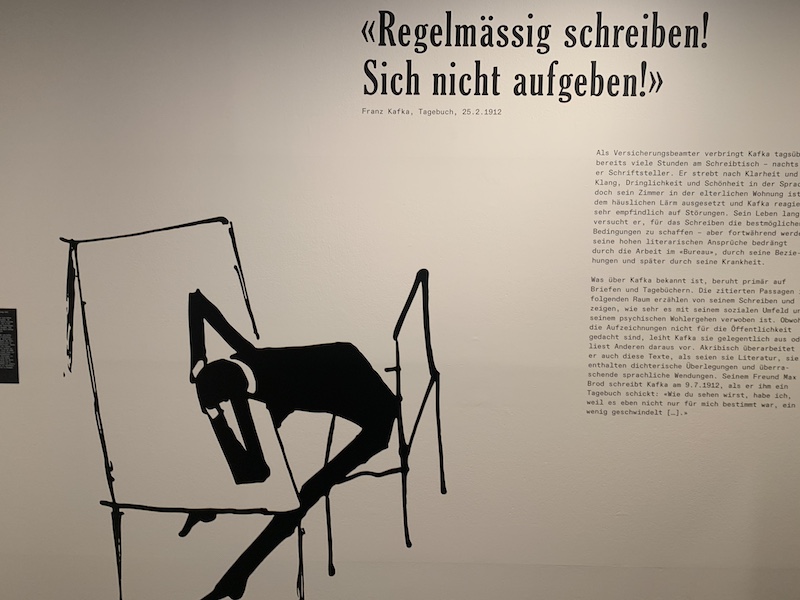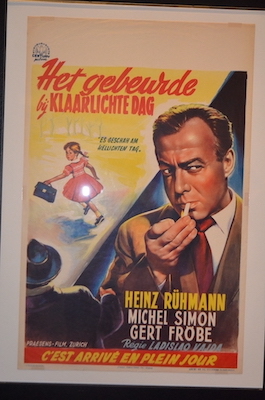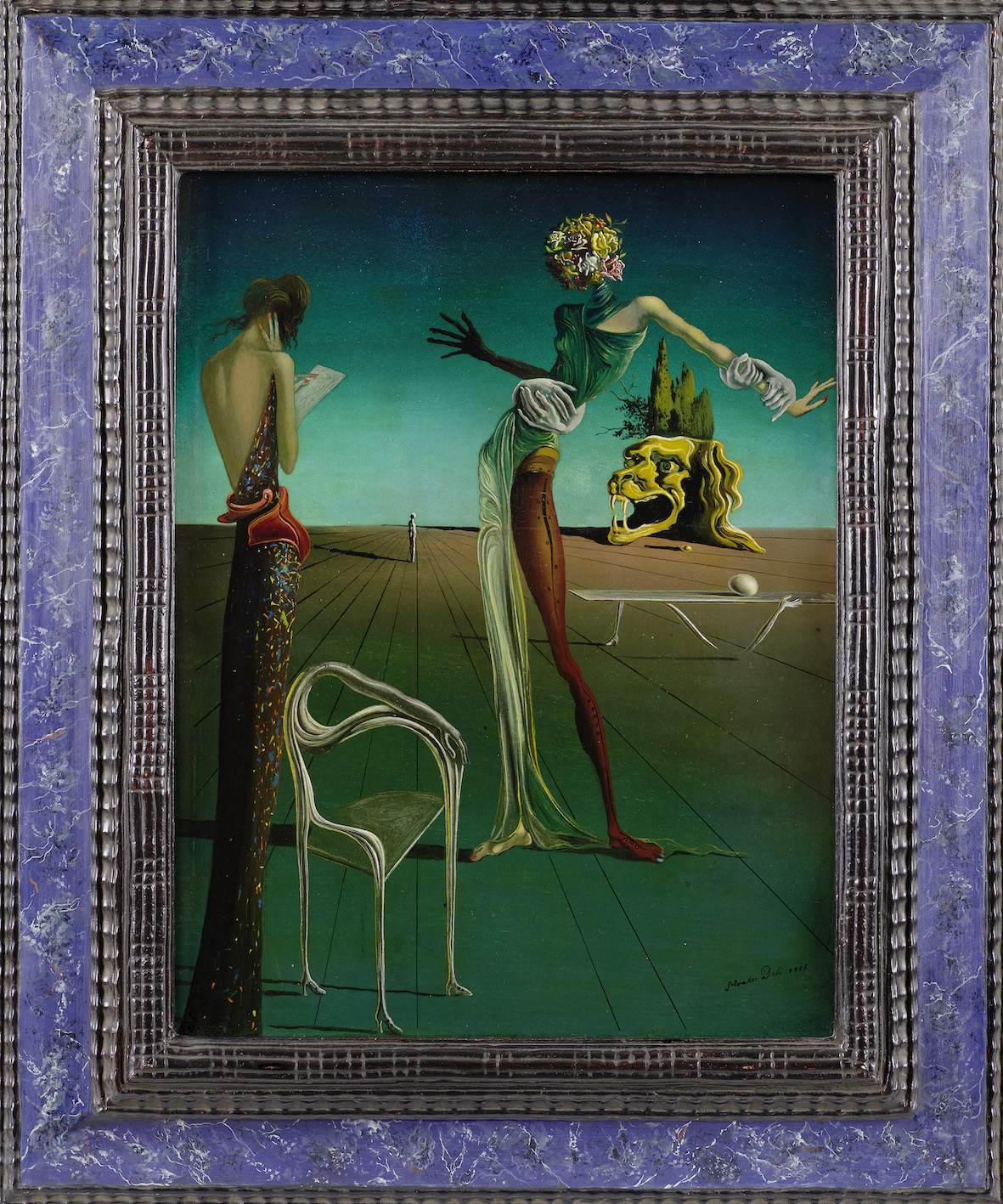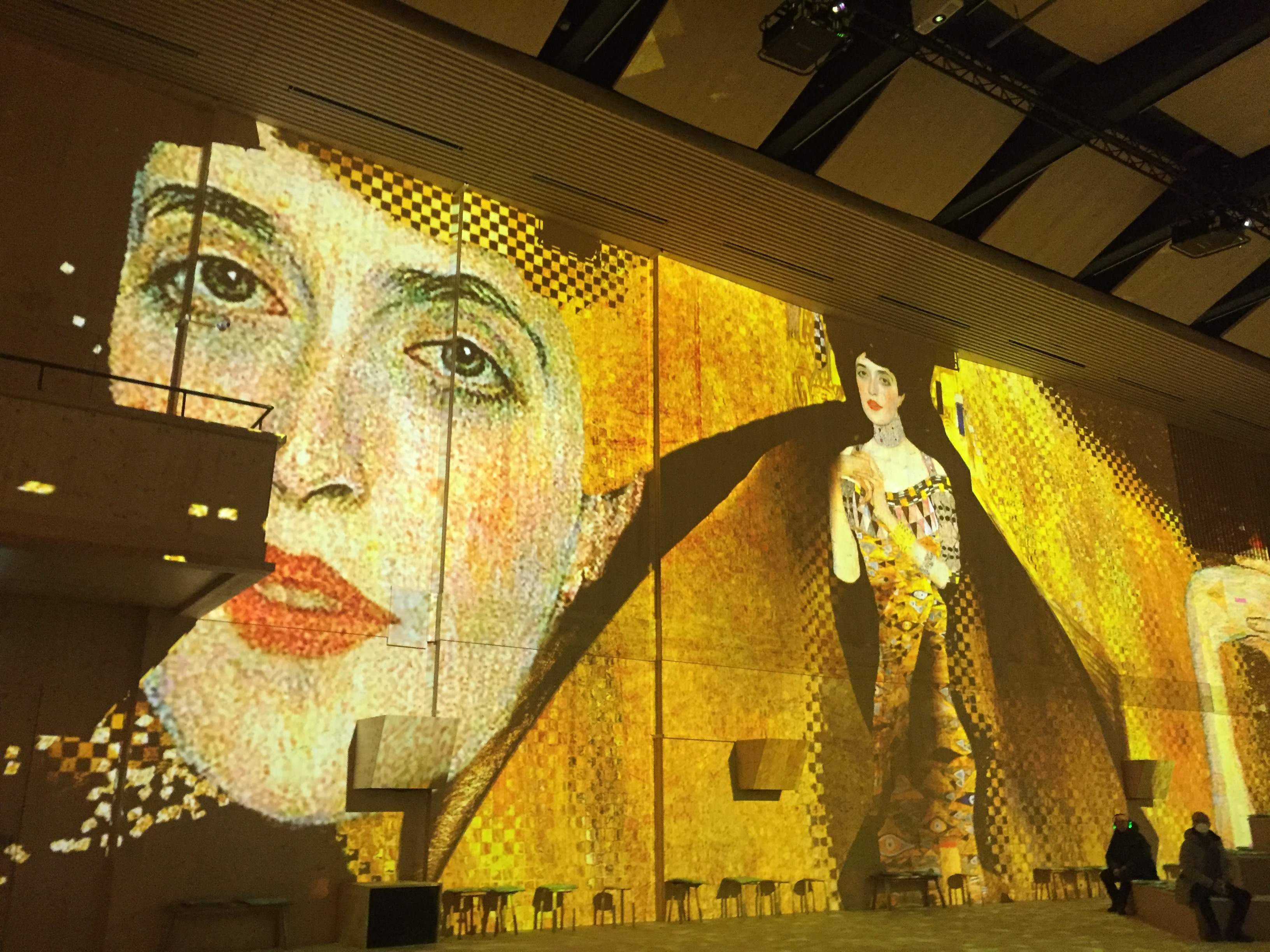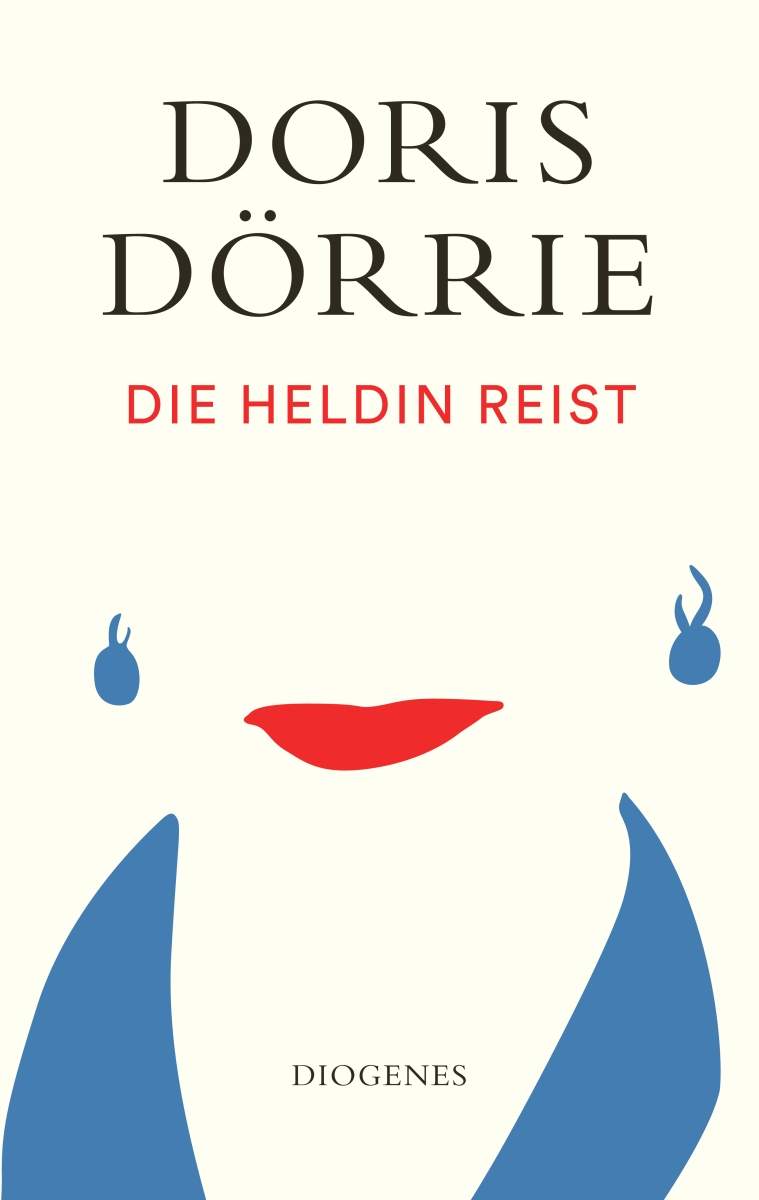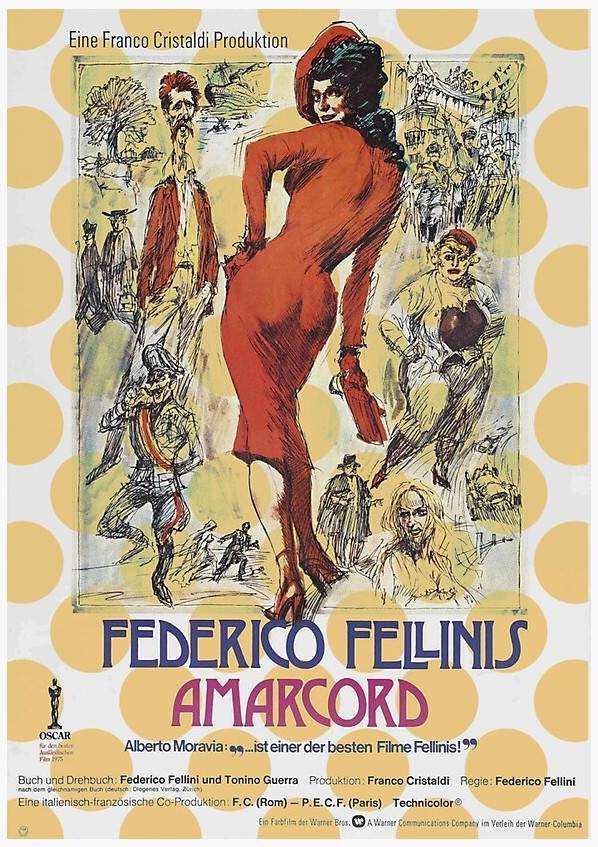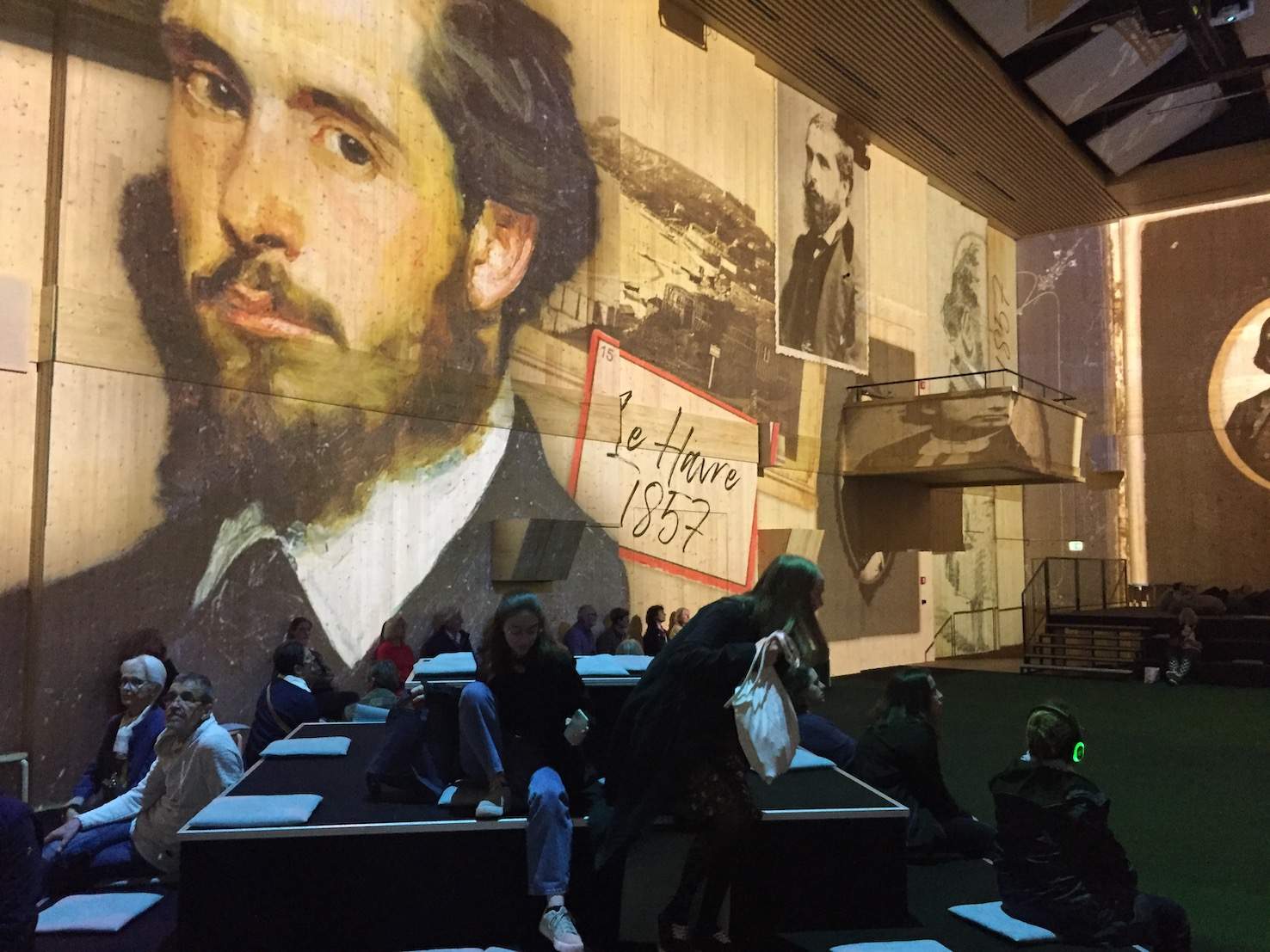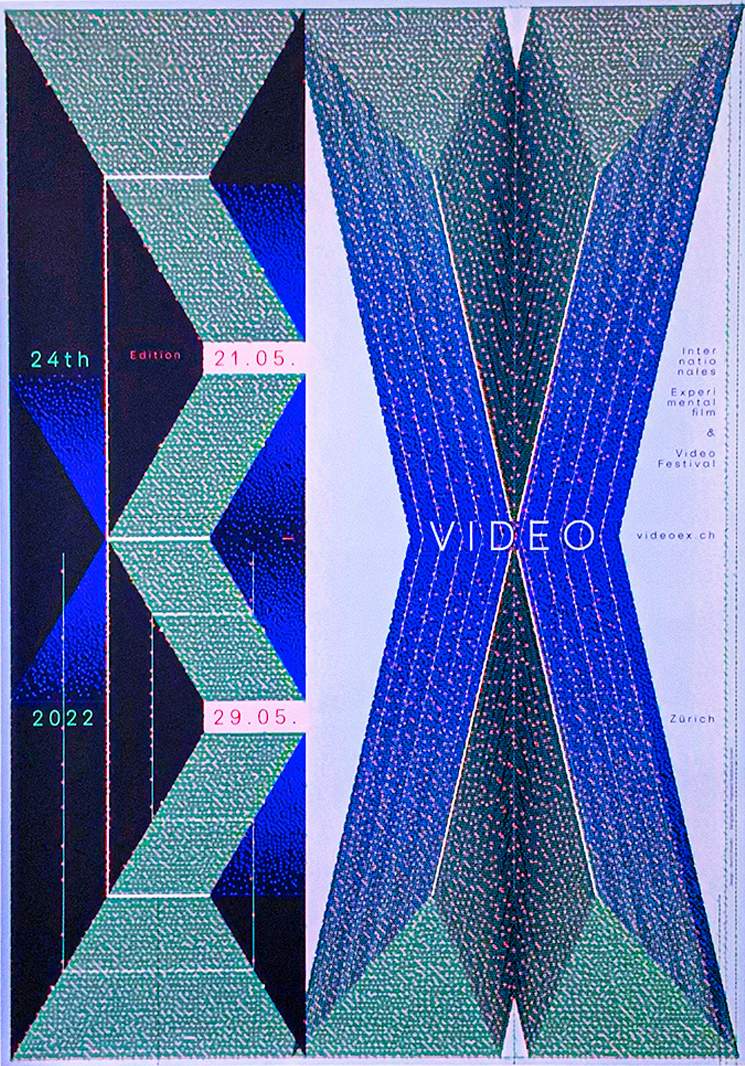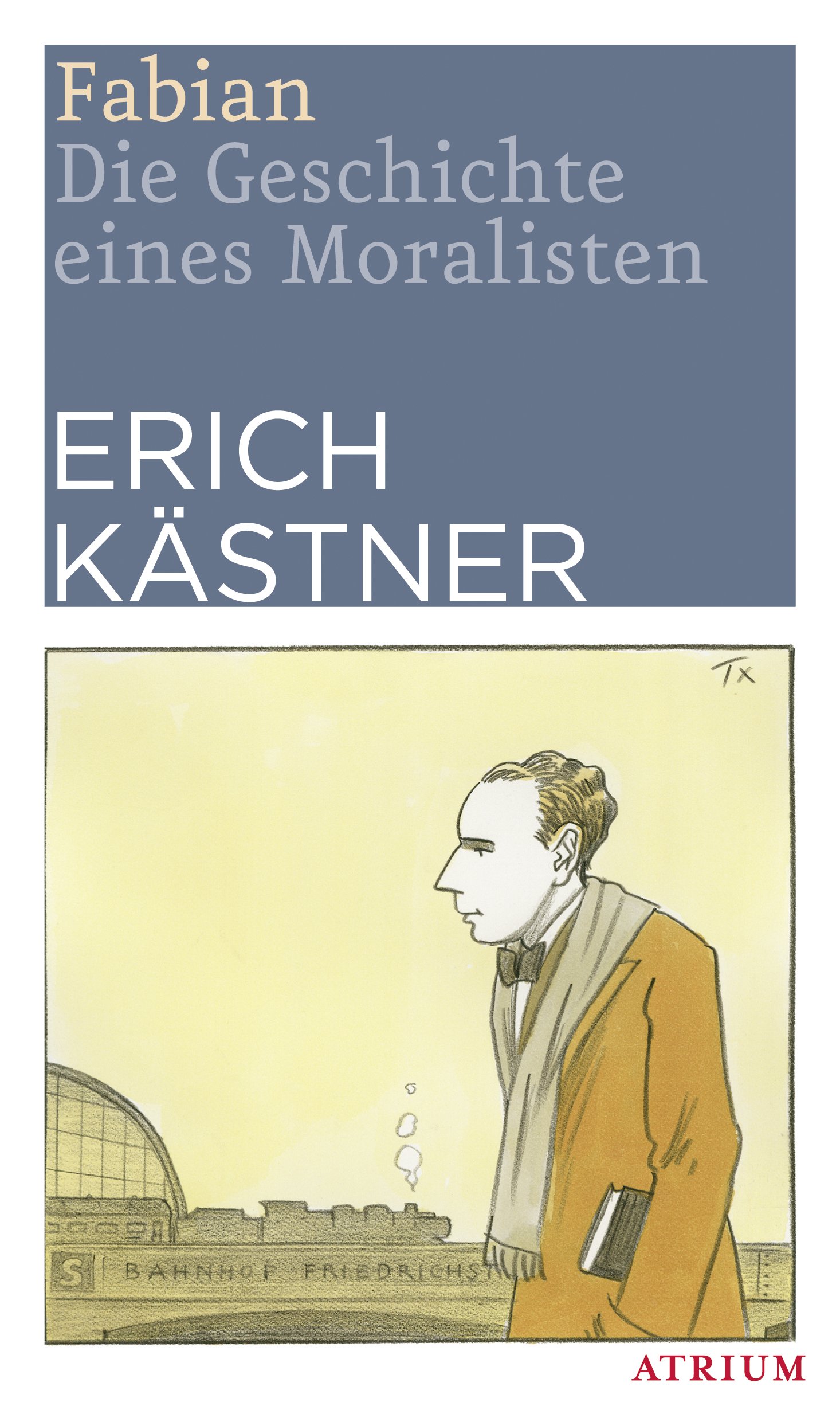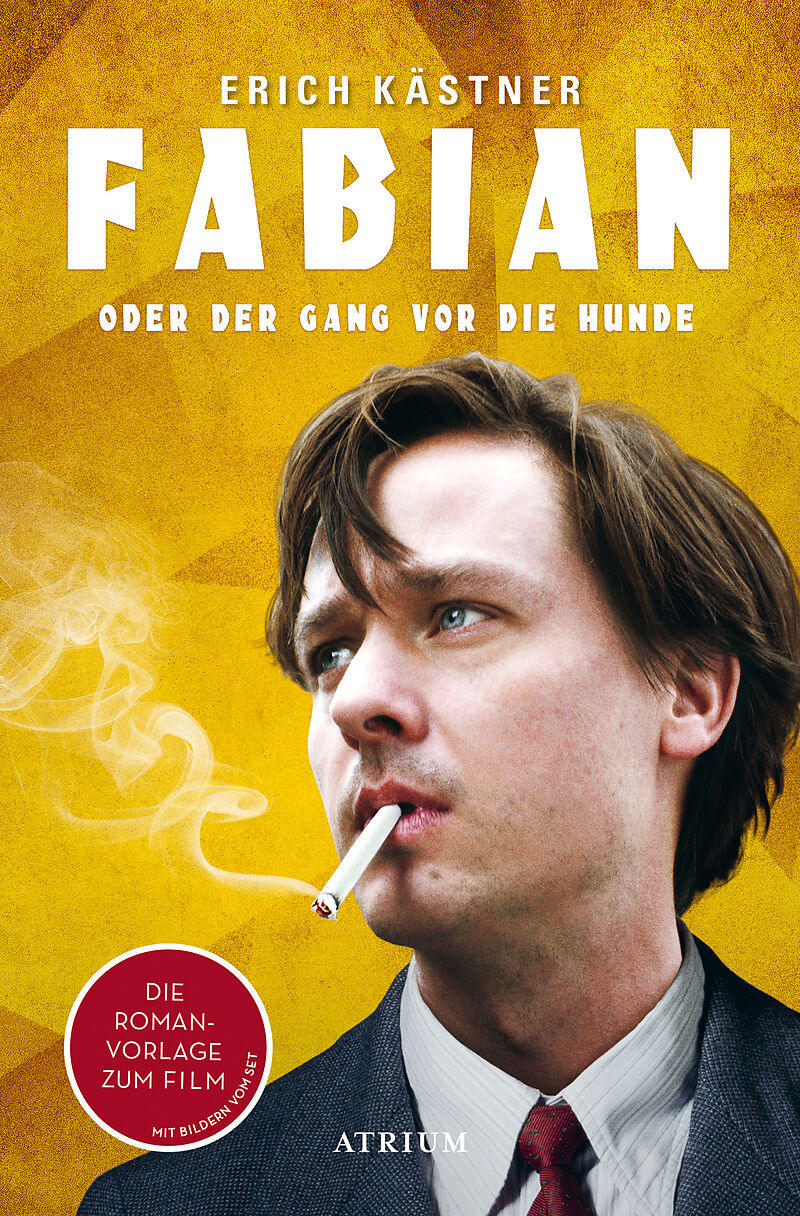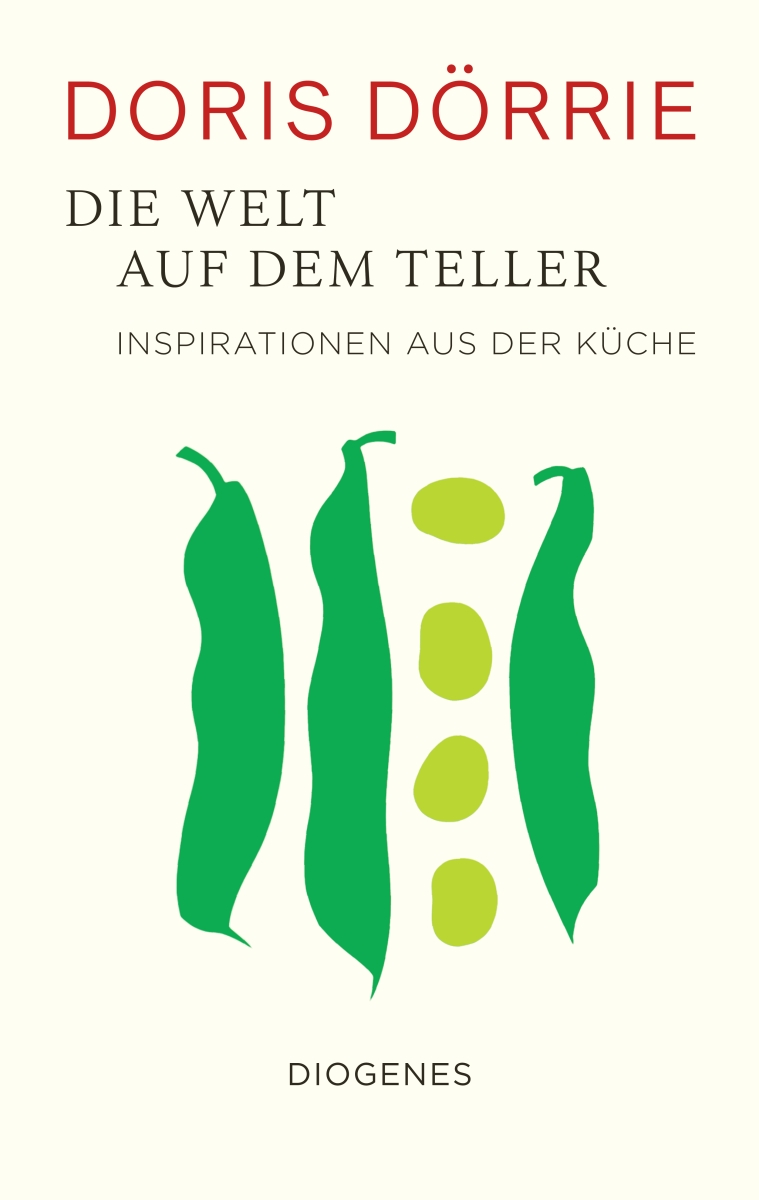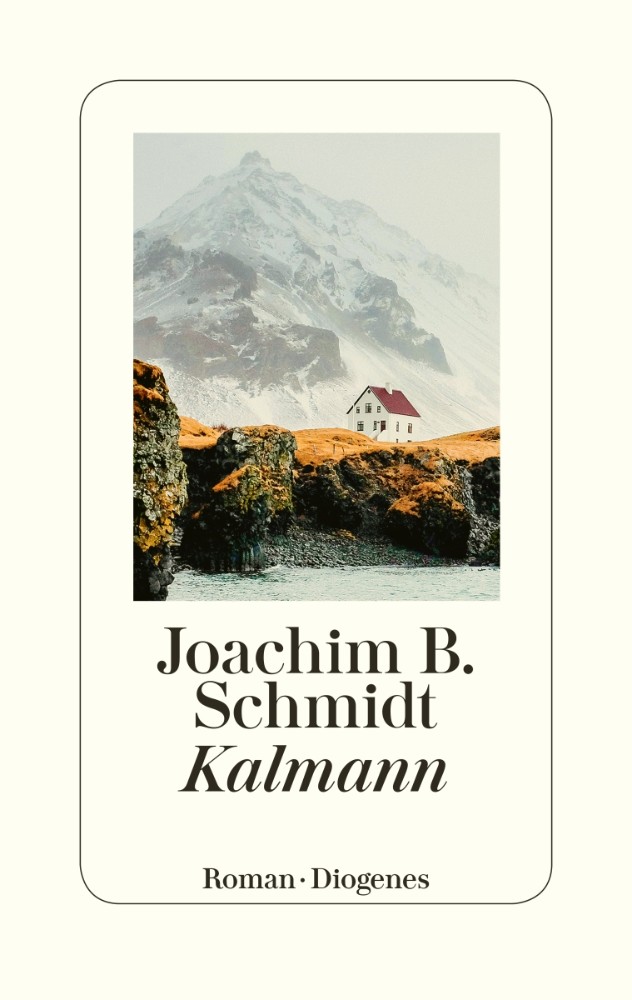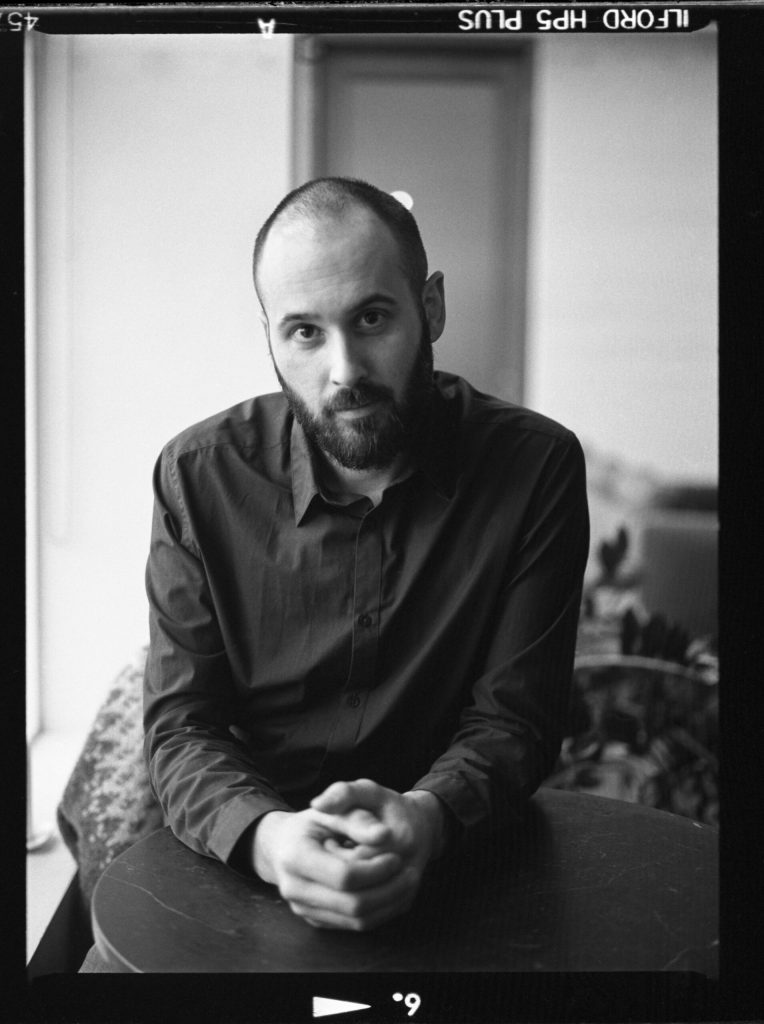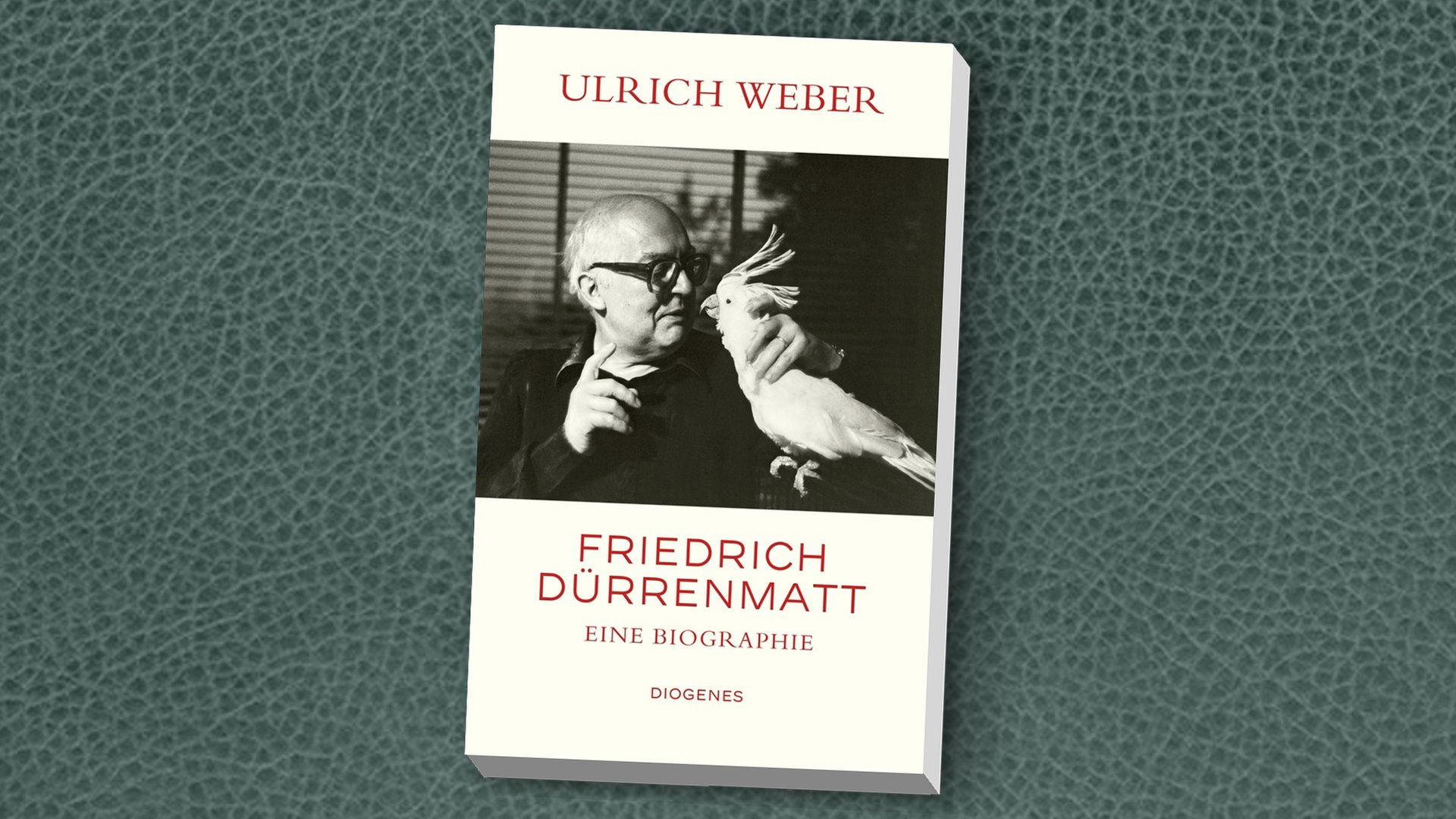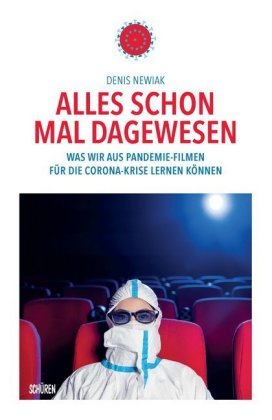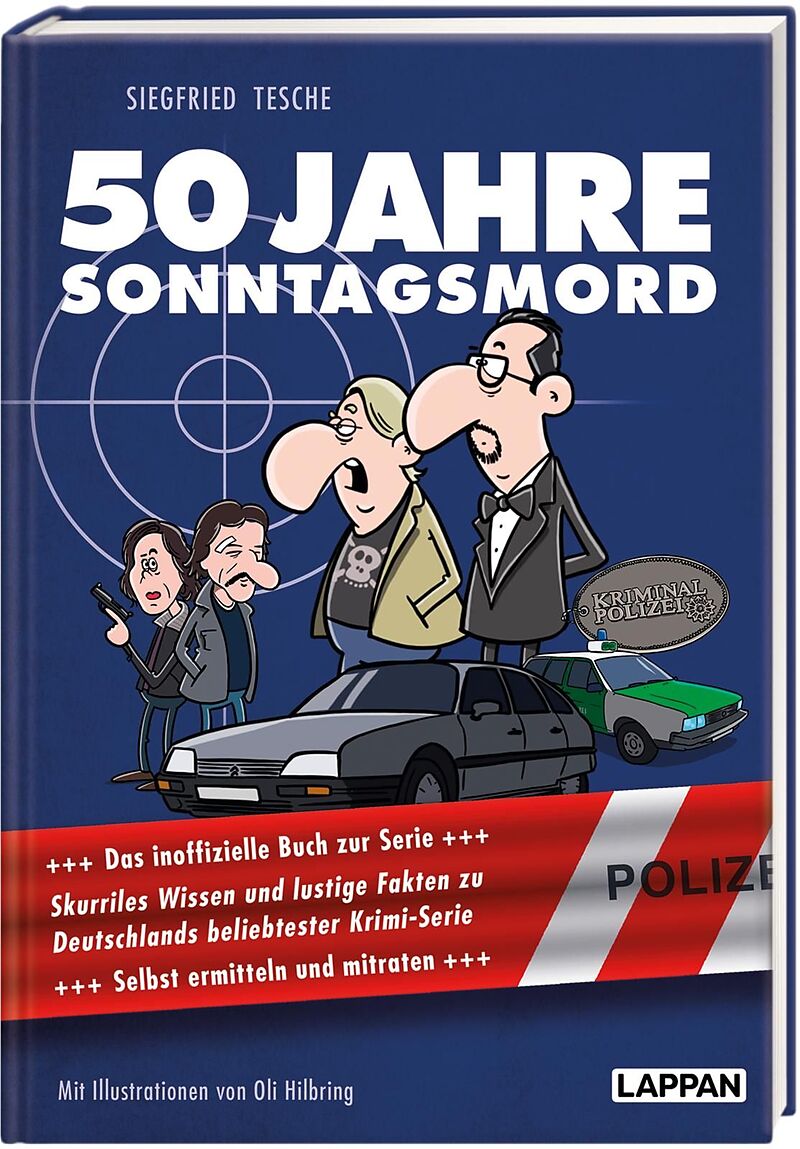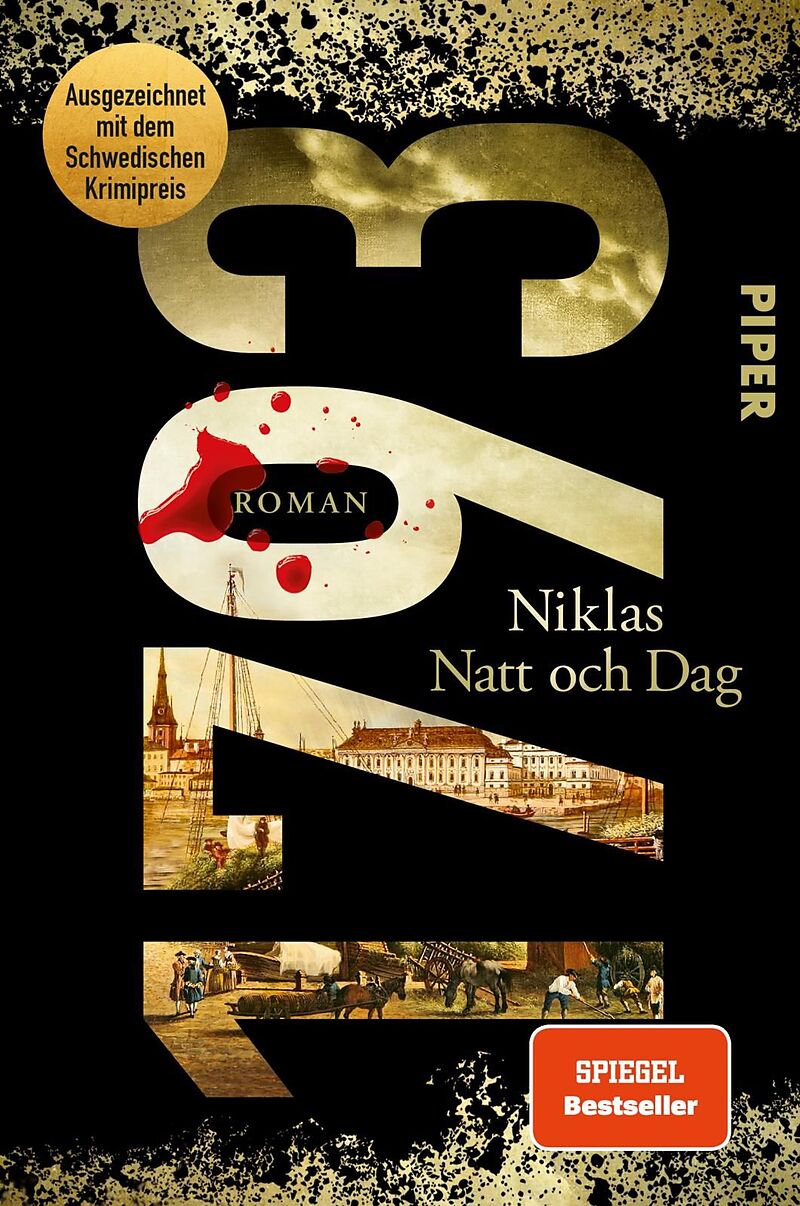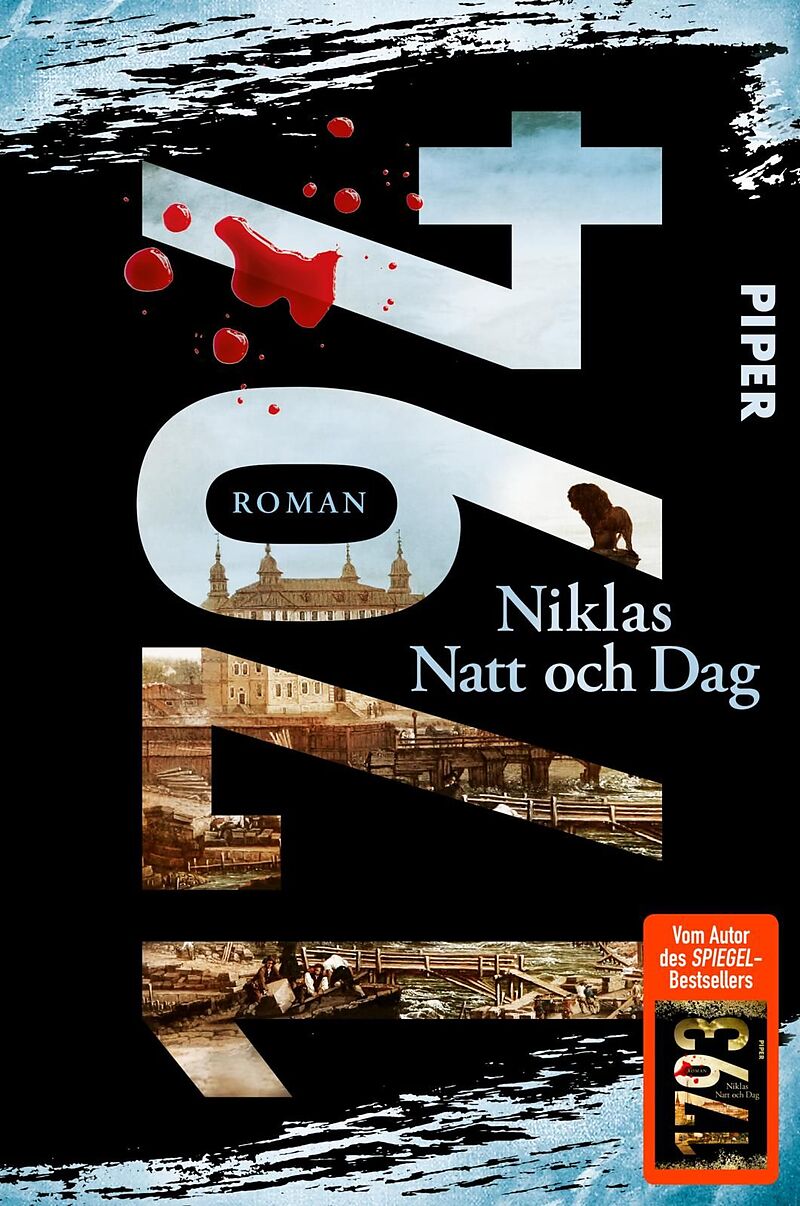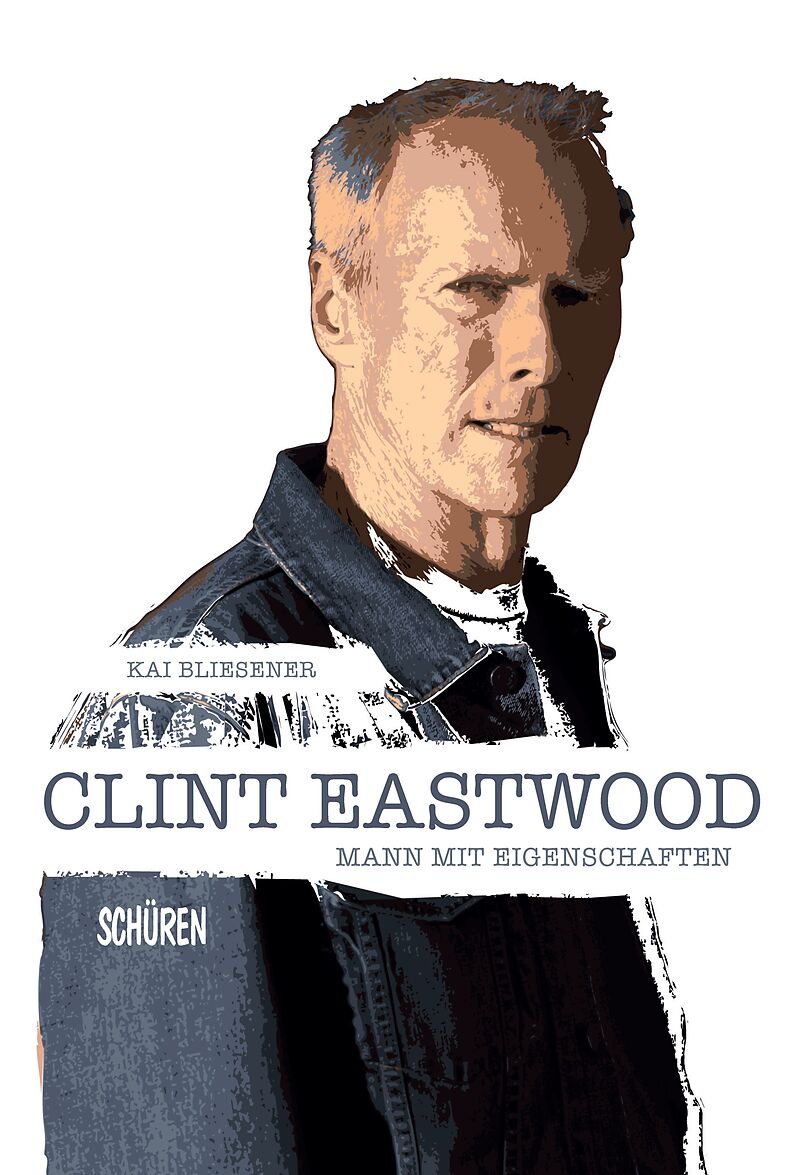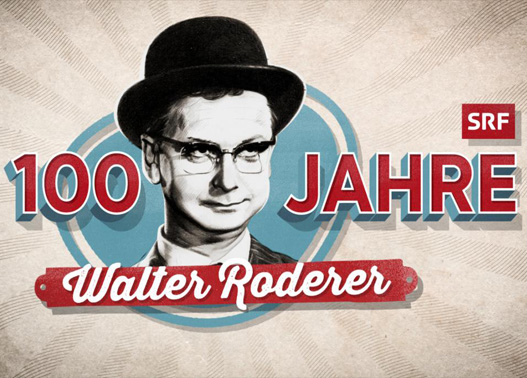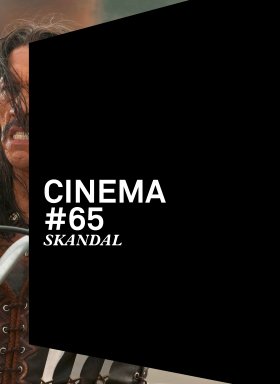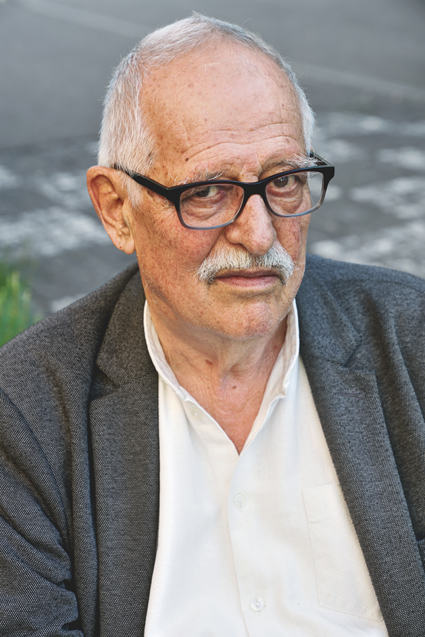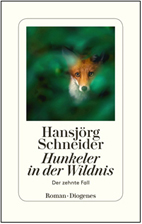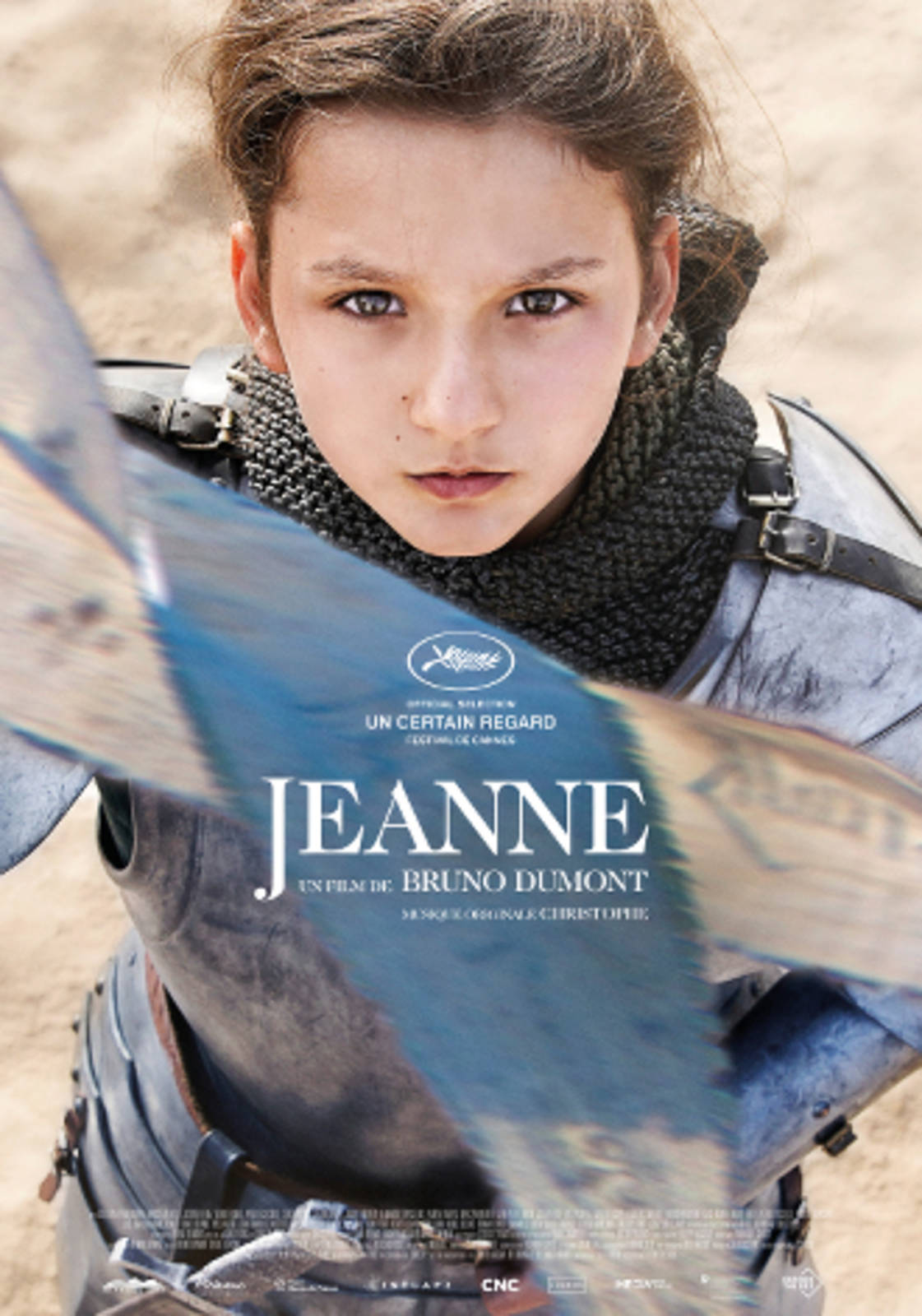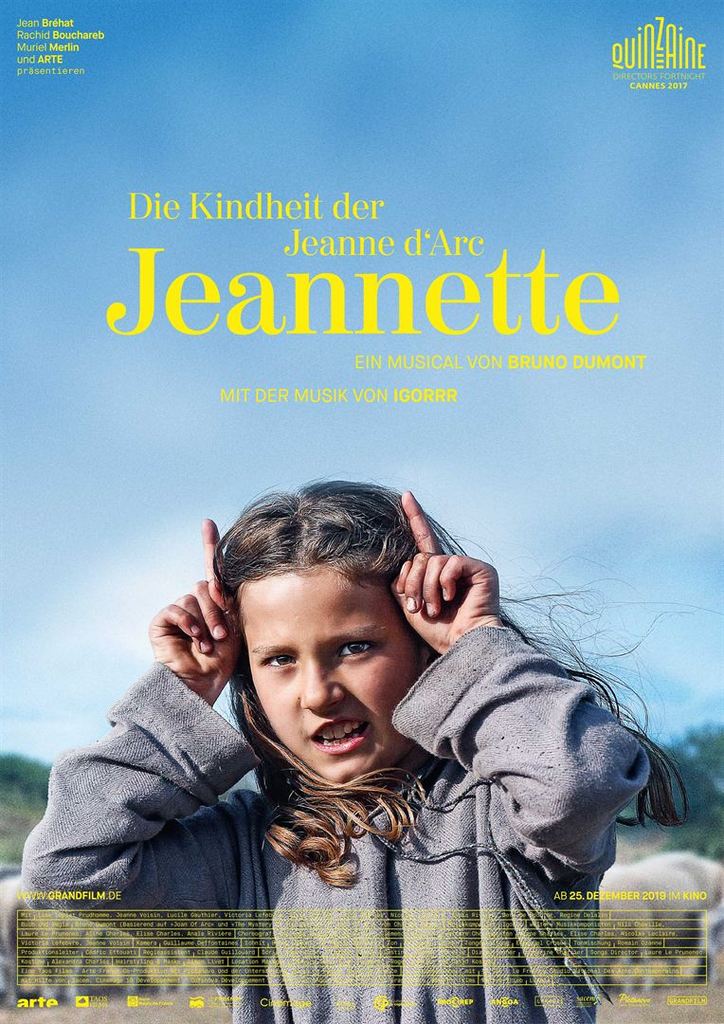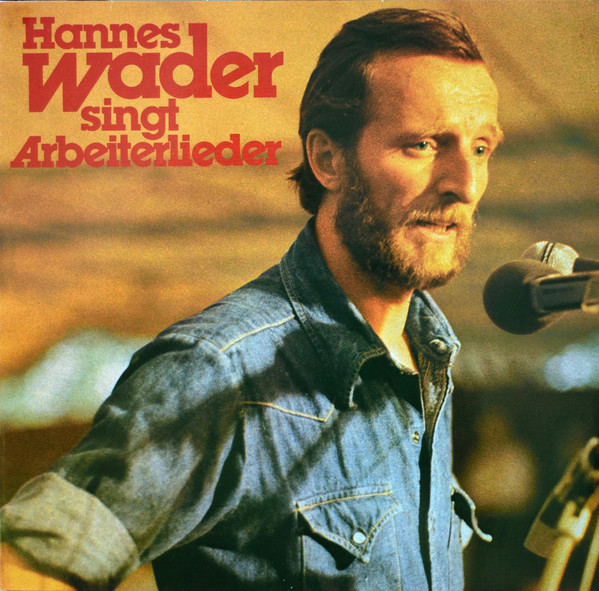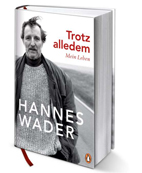«Bad zu Leuk» von Hans Brock d. Ä. um 1597, Kunstmuseum Basel. (Bild: Schweizerisches Nationalmuseum)
Körper, Kult und Kirche
Das Badevergnügen erlebte seit den Städtegründungen im 11. und 12. Jahrhundert grossen Aufschwung, auch eine Folge von Epidemien und Pest. Badestuben waren gesellige Orte und entwickelten sich zu Stätten des Vergnügens, denen häufig Freudenhäuser angegliedert waren. Natürlich von der Kirche beargwöhnt.
Im Kapitel «Begehrt» wird dieser Aspekt besonders beleuchtet: vom «Liebesgarten mit Schachspielern» den ekstatischen «Moriskentanz» (15. Jahrhundert) bis zur «Versuchung des Müssiggängers» (1498 von Albrecht Dürer). Aus Sicht der Kirche war Sexualität im Mittelalter «ein mit Normen, Sünden und Strafen durchtränktes Lebensfeld.» (Katalog) In der Ehe war der Beischlaf sanktioniert. «All jene, die nur wegen der Lust kopulierten, wurden zu ‘Unzuchtssündern’ gestempelt.» (Franz X. Eder im Katalog über «Wollust und Sünde»). Dabei hatte Augustinus bereits im 4. Jahrhundert Prostitution als notwendiges Übel geduldet, «das die soziale Ordnung und den häuslichen Frieden sicherte und damit schlimmere moralische Gefahren von der Gemeinde fernhielt.»
Die Sorge um den Körper war auch im Mittelalter ein Thema. Nicht nur die Kräuterkunde der Benediktinerin Hildegard von Bingen im 12. Jahrhundert ist bekannt, sondern auch zahlreiche Handschriften vor allem im Kloster St. Gallen zeugen von medizinischer Theorie und Praxis. Erwähnt und ausgestellt wird etwa Ekkeharts Klosterchronik. Er dokumentiert u.a. die Verarztungen des St. Galler Mönchs Notker. Diese Zeugnisse dokumentieren, dass bereits im Mittelalter erstaunliche Diagnosen gestellt und erfolgreiche Behandlungen durchgeführt worden sind. «Der menschliche Körper wurde ernst genommen», heisst es.
Was es mit toten Körpern auf sich hat, zeigt ein weiteres Kapitel – von der Grablegung, Totentanzfiguren, Grabmälern bis zu Grabschreinen und Reliquien. Zu sehen ist u.a. das Armreliquiar des Heiligen Ursus von 1474. Das Knochenfragment wurde nicht in einer Vitrine oder einem Kasten wie sonst üblich aufbewahrt, sondern in einem künstlichen Unterarm. Die Reliquien von Heiligen, so der Glauben im Mittelalter, wirken weiter zum Wohl und Gedeihen beispielsweise einer Stadt und Gesellschaft.
«Der Körper ist heilig, eine Schöpfung Gottes, in ihn wird die unsterbliche Seele des Menschen bei der Geburt hineingeboren», so Denise Tonella, Direktorin des Nationalmuseums, im Vorwort. «Er gilt aber auch als Wohnort der Sünde und der Begierde. Der Körper wird verehrt und glorifiziert, wegen seiner Sündhaftigkeit aber auch geschlagen und gepeinigt.» Die Ausstellung legt davon eindrücklich Zeugnis ab. Und noch etwas: Der Mensch und seine Sicht auf den Körper, sein Empfinden, seine «Körpersprache» haben sich nicht wesentlich geändert. Er ist Heimstätte und Werkzeug, Lustobjekt und Leidstätte.
Der Ausstellungskatalog, von verschiedenen Autoren verfasst, vertieft, ordnet ein und bietet spannenden Lesestoff – vom «Multimedialen Leib Christi im Mittelalter» über «Körperideal und Sport» bis zur «Geschichte der Gewalt» und «Reliquiare und die Gegenwart der Heiligen». Verlag Scheidegger und Spiess, Zürich 2024, 37.– Franken.
landesmuseum.ch/begehrt-umsorgt-gemartert
Veröffentlicht März 2024
Die Ausstellung im Strauhof spürt Kafka's Werk nach. (Bild: rbr)
Ein literarisches Phänomen –
Von geschlossenen Türen, Ausweglosigkeit und Ohnmacht
Mit seinem Namen ist ein Adjektiv verbunden, das sich aus seinen Romanen «Der Prozess» und «Das Schloss» erklärt: Kafkaesk – meint eine Situation, die rätselhaft, unerklärbar, bedrohlich erscheint, bezeichnet ein Gefühl der Unsicherheit und des Ausgeliefertseins angesichts einer anonymen gesichtslosen Macht oder Administration. «Kein Schriftsteller unserer Zeit und wahrscheinlich keiner seit Shakespeare ist dermassen überinterpretiert und in Schubkästen gesteckt worden. Jean-Paul Sartre nahm ihn für den Existenzialismus in Anspruch, Camus für das Absurde, sein lebenslanger Freund und Herausgeber Max Brod überzeugte mehrere Gelehrtengenerationen, dass sich in Kafkas Parabeln die komplizierte Suche nach einem unerreichbaren Gott ausdrückte.» So beschreibt David Zane Mairowitz den Dichter, Denker und Maler Franz Kafka in seinem Buch, illustriert vom Comiczeichner Robert Crumb. Drastisch führen die beiden nicht nur Kafkas Lebensstationen vor Augen, sondern auch gesellschaftliche und politische Gegebenheiten, Welt und Umfeld. Wie erging es dem jüdischen Bürger in Prag, dem deutschstämmigen Versicherungsbeamten, der zwischen die Fronten in einem antisemitistischen Klima geriet, zwischen Royalisten und Revoluzzern? Wie entstanden seine fragmentarischen Werke? Welche Rolle spielte sein Vater?
«Wir schreiben das Jahr 1914», so Autor Mairowitz, «Obwohl Hermann Kafka (Kafkas Vater) noch immer einer der Gründe für die fieberhafte nächtliche Schreiberei seines Sohnes ist, so ist sie doch inzwischen über die Banalität ihres ödipalen Konfliktes hinausgewachsen; andere wichtige Einflüsse sind am Werk. Kafka schreibt über Macht, Unterwerfung und Erniedrigung. Über die überlegene Macht, die ihre Objekte dazu bringt, sich zu etwas Niedrigem zu machen, das auf seinem kleinen Bauch davonkrabbeln kann.»
Kafka hat nie öffentlich Partei ergriffen und wurde vom faschistischen Strom der Zeit erfasst. Zu dieser Zeit verfasste Kafka einen Satz, der Weltliteratur wurde: «Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn, ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.» Im Roman «Der Prozess» wird Josef K. nie der Prozess gemacht, gleichwohl wird er verurteilt. Sein unvollendeter Roman «Das Schloss» hat Berge von Interpretationen provoziert. Landvermesser K. wird in ein Dorf beordert, um ein Schloss aufzusuchen. Er gerät in ein undurchschaubares Labyrinth. Seine Bemühungen enden an Hierarchien und Strukturen. Der Schluss ist offen. Laut Max Brod sollte der Landvermesser auf dem Sterbebett erfahren, dass die Schlossherren ihm erlauben, im Dorf zu bleiben. «Stets trachtet K. danach, zum Schloss zu kommen, auch als es immer weiter von ihm wegrückt. Im ‘Prozess’ und in der ‘Strafkolonie’ verurteilte und bestrafte das Gesetz, im ‘Schloss ist es völlig indifferent und vage», kommentierte Mairowitz. Der Mensch, Mächten und Strukturen ausgeliefert – nicht nur gestern.
Jüngst hat sich ein anderer Comiczeichner mit Franz Kafka beschäftigt: der Wiener Nicolas Mahler. Er nähert sich dem Literaten auf künstlerische Weise, nimmt den Zeichenstil Kafkas auf und führt ihn weiter. Erst nach Kafkas Tod 1924 wurden Berge von Zeichnungen entdeckt. In seinem Buch «Komplett Kafka» zeichnet Mahler Kafkas Leben nach – von 1852 (Rabbi Löw) über Kafkas Liebschaften (Felice Bauer), seiner Arbeit an «Die Verwandlung» oder an «Ein Hungerkünstler» bis zu Kafkas Freund Max Brod. Die Texte sind knapp und dienen der Orientierung oder Charakterisierung, beispielsweise bei Kafkas Freund Max Brod. «Brod selbst ist schon optisch das Gegenteil. Er ist klein, etwas verdreht, eine Rückgratverkrümmung zwingt ihn zum Tragen eines Geraderichters, eines aus Metallstangen bestehendes Gestell», so Mahler.
Kauzig, komisch, kurios – der Mensch Kafka, der sein Heil im Schreiben und in der Verwandlung suchte. Franz Kafka, 1883 in Prag geboren und 1924 gestorben, verfügte, dass Freund Max Brod seine Schriften vernichten sollte, doch der weigerte sich und rettete so ein literarisches Werk, das bis heute aktuell ist, das Leser wie Kritiker beschäftigt. Im Band mit den «Tieren» beispielsweise finden sich Texte wie «Der Bau», «Ein Bericht für eine Akademie» oder «Josefine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse». Im « Bau» geht es um Abschottung aus Angst vor Eindringlingen und einem verhängnisvollen Reduit («Aus Sicherheitsdenken wird Sicherheitswahn»). Im «Bericht für eine Akademie», eigentlich eine Assimilationstragödie, ist ein Affe die zentrale Figur. Bei «Josefine», einer Geschichte ohne Handlung, wird eine pfeifende Mäuse-Diva mit allerlei Marotten beschrieben, die am Ende verschwindet, ohne Spuren zu hinterlassen. Diese Erzählung, wenige Monate vor Kafkas Tod niedergeschrieben, lässt eine deprimierende Interpretation zu: Kunst scheint leicht ersetzbar, scheint eine Pose mit Unterhaltungswert. Ob Kafka das auch von seinem Werk dachte und deshalb die Vernichtung seiner Schriften wünschte?
Wie fasst man einen Autor wie Franz Kafka in einer Ausstellung? Im Zürcher Strauhof, prädestiniert für Literatur und literarische Themen, hat einen naheliegenden Weg gefunden. In der Ausstellung «Kafka – Türen, Tod und Texte» dominieren Texte, heisst Zitate, Kommentare, schriftliche Zeugnisse, ergänzt durch Fotos und Zeichnungen. Und die wurden erst nach seinem Tod entdeckt. Kafka, der Prager mit deutsch-jüdischem Hintergrund, hat 40 kurze und längere Erzählungen in Zeitschriften und Büchern veröffentlicht. Nach einer einführenden Zeittafel mit entsprechenden Bildern kann man sich in einem intimen Raum auf Kafka-Texte einlassen, sozusagen aus zweiter Hand. Hier werden (leider) nicht Originaltexte vorgetragen, sondern Kommentare, gesprochen vom Zürcher Schauspieler Jonas Gygax. Ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt der Ausstellung sind Türen, Sinnbild für Gliederung von Raum und Handlung und Instrument der Abschottung von der Aussenwelt bei Kafka. Ein Raum ist seiner Biografie, Wirkung und Deutung gewidmet. Kafka bleibt vieldeutig und vielschichtig, spannend.
Gut getimt, just zum 100. Todesjahr kommt ein Spielfilm in die Kinos, der von Kafkas letzter Liebe erzählt: «Die Herrlichkeit des Lebens». Der Filmtitel ist freilich etwas optimistisch gewählt, denn es geht um das Jahr 1923. Dazumal ist Kafka bereits von seiner schweren Krankheit (Tuberkulose) gezeichnet. Der Spielfilm von Georg Maas und Judith Kaufmann basiert auf dem Bestseller (2011) von Michael Kumpfmüller. Franz Kafka (Sabin Tambrea) lernt an der Ostsee (Heilbad Graal-Müritz) die unbeschwerte jüdische Tänzerin Dora Diamant (Henriette Confurius) kennen und lieben. «Auf der Schwelle zum Glück», schreibt er an Max Brod. Sie ziehen nach Berlin-Steglitz, mit einem «Koffer voll Worte und Papier». Dora wird ihn bis zum Tod am 3. Juni 1924 begleiten und pflegen. Das Melodrama steht und fällt mit den Hauptdarstellern, schwankt zwischen Lebenslust und Schwermut. Der sanfte Liebesfilm kommt fast ohne literarische Bezüge aus, sieht man von Kafkas Briefen an seinen Vater ab. Sehenswert.
«Kafka – Türen, Tod & Texte», Ausstellung im Strauhof, Zürich, bis 12. Mai 2024, begleitet von Gesprächen und Lesungen, beispielsweise am 14. März mit «Was mir Kafka bedeutet?», Autoren über Kafka, oder am 15. März «Komplett Kafka», Zeichner Nicolas Mahler liest aus seinem Kafka-Buch.
Georg Maas und Judith Kaufmann «Die Herrlichkeit des Lebens», Spielfilm. Kinostart am 21. März.
David Zane Mirowitz und Robert Crumb «Kafka», Reproduktion 2024, Paperback Fr. 12.80
Nicolas Mahler «Komplett Kafka», Suhrkamp 2023, Fr. 22.00
Franz Kafka «Erzählungen von Tieren», Fischer Taschenbuch 2023, Fr. 18.80
Veröffentlicht Februar 2024
Ein Streifzug durch die Schweizer Filmgeschichte im Landesmuseum. (Bild: Schweizerisches Nationalmuseum)
Links: Ein internationaler Erfolg in Europa: «Es geschah am hellichten Tag» auf Holländisch. (rbr)
Es geschah nicht nur am hellichten Tage
1923 bewarb sich Lazar um einen Schweizer Pass, den er auch erhielt. Am 14. März 1924 wurde die Firma Praesens-Film AG ins Handelsregister eingetragen. Ziel der Produktion waren Reklame- und Industriefilme. Wechsler suchte einen Kameramann und stiess auf Walter Mittelholzer. Er überzeugte den Piloten mit der Kamera, als Teilhaber der Praesens beizutreten. Mittelholzer unternahm weitere «Kulturreisen» für Junkers, so auch nach Teheran («Persienflug»). Praesens-Film etablierte sich als Verleiherin von Reisefilmen. Doch wirklich wirtschaftlichen Erfolg hatte Wechsler mit Reklamefilmen für Tobler, Gilette oder Sunlight beispielsweise. Er knüpfte ein Netz mit Kinobetreibern, die seine Filme zeigten. So wurde Praesens Monopolist des Reklamefilms, und das Firmenlogo nahm seine endgültige Form an – mit einer Filmrolle und zwei Flügeln. Den Durchbruch als Filmproduzent gelang Praesens mit Mittelholzers «Afrikaflug» 1927. «Zwei Schweizer Himmelstürmer» überschrieb Benedikt Eppenberger das erste Kapitel seines Praesens-Buches «Heidi, Hellebarden & Hollywood». Auf über 300 Seiten schildert er detailliert die Erfolgsgeschichte der Praesens-Film. Ein Schmöker, der nicht nur ein gewichtiges Kapitel Schweizer Kulturgeschichte beschreibt, sondern auch Zeitgeschichte widerspiegelt. Von den Anfängen um 1923 («Praeteritum») übers «Praesens» (1940–1951) bis zum «Futurum» (1952–2024). Der Schlussbogen spannt sich so von den «Heidi»-Filmen bis zur Dürrenmatt-Verfilmung «Das Versprechen» mit Jack Nicholson 2001.
Das Landesmuseum in Zürich ehrt Praesens-Film mit einer kleinen, kompakten Ausstellung: «Close-up. Eine Schweizer Filmgeschichte». Der Untertitel ist etwas anmassend, endet sie doch bereits 1962. An der «Film»-Schau mit kleineren Filmausschnitten, Dokumenten, Fotos und Requisiten war die Cinématèque Suisse wesentlich beteiligt. Eingeteilt in Abschnitte wie «Auftragsfilme» («Frauennot – Frauenglück», 1930), «An der Grenze», «Humanitäre Tradition», «Heimatidylle» oder «Zwischen Bühne und Kamera» (Ann-Marie Blanc und Heinrich Gretler) macht «Close-up» neugierig, die alten Filme wiederzuentdecken. Ein witziges Detail der Schau ist ein Pferdekopf (Kostüm), Requisit aus «Gilberte de Courgenay». Dazu sind Plakate, Briefwechsel, Originaldrehbücher und sechs Linolschnitte vom Grafiker Clément Moreau (1903–1988) zum Thema «Grenzübertritt» zu sehen.
Die Schweizer Filmgeschichte begann zwar nicht mit der Praesens-Film AG. Doch diese Produktionsfirma setzte Massstäbe – mit Lazar Wechsler aus Piotrków Trybunalski (Russland-Polen) und dem St. Galler Walter Mittelholzer. Vor dem Zweiten Weltkrieg trug man zur geistigen Landesverteidigung bei – mit Filmen wie «Gilberte de Courgenay» mit Anne-Marie Blanc. Mit den Spielfilmen «Marie-Louise» (1944) oder «Die letzte Chance» (1945) wurde eine neue humanistische Ära eingeläutet. Die Geschichte um das französische Flüchtlingskind Marie-Louise, das für drei Monate in der Schweiz aufgenommen wurde, bewegte die Herzen und wurde mit einem Oscar fürs Drehbuch belohnt. Regisseur Leopold Lindtberg vollendete das Drama nach einigen Querelen mit Produzent Wechsler. Lindtberg hatte für die Praesens-Film bereits die Filme «Wachtmeister Studer» (1939. «Landammann Stauffacher» (1941) oder «Der Schuss von der Kanzel» (1942) realisiert. Der grosse internationale Durchbruch gelang mit «Marie-Louise» und mit dem Flüchtlingsdrama «Die letzte Chance» (1945).
In der Nachkriegszeit hatte das Publikum die (Kino-)Nase voll von Flüchtlingsschicksalen. Heimische Filme waren gefragt. Das war die grosse Zeit von Regisseur Franz Schnyder, der mit «Heidi und Peter» (1954), mit den Gotthelf-Verfilmungen «Uli der Knecht» (1954) und «Uli der Pächter» (1954) oder «Anne Bäbi Jowäger» reüssierte. Abgelöst wurde er quasi durch Kurt Früh und seinen Praesens-Filmen «Hinter den sieben Gleisen» (1959), «Es Dach überem Chopf» (1962) oder «Der 42. Himmel» (1962). Höhepunkte waren dann die Produktionen «Es geschah am hellichten Tage» (1958) von Ladislao Vajda, mit Gert Fröbe und «Die Ehe des Herrn Mississippi» (1961) von Kurt Hoffmann.
Die Filmproduktion wurde 1972 quasi stillgelegt. In den Siebzigerjahren übernahmen die Brüder Martin und Peter Hellstern (Rialto-Film) die Praesens-Leitung. Die Firma beschränkte sich auf Filmverleih. Und es geschah ein kleines Wunder: Mitte der Siebzigerjahre starteten die Hellstern-Brüder eine Comeback-Aktion der «Heidi»-Filme. «Dieses Comeback im Kino war ein gewaltiger Erfolg, und Praesens konnte fast eine Million Franken in die leeren Kassen buchen», schreibt Benedikt Eppenberger in seiner Praesens-Chronik. Seit 2009 werden auch wieder Praesens-Filme produziert. Im März soll der Spielfilm «Die Herrlichkeit des Lebens» in die Kinos kommen, ein Drama über Franz Kafka und seine Lebensgefährtin Dora Diamant.
Parallel zur Ausstellung präsentieren das Filmpodium Zürich Filme zu «100 Jahre Praesens» (bis 15. Februar) und das Kino Rex in Bern «Die Heimatfabrik: 100 Jahre Praesens Film» (1. bis 28. Februar 2024).
Ebenfalls zum Jubiläum publizierte der Historiker Benedikt Eppenberger sein fundiertes Buch «Heidi, Hellebarden und Hollywood. Die Praesens-Film-Story», NZZ Libro 2024, Fr. 23.90
Veröffentlicht Januar 2024
Ein Blick in die Ausstellung: Andreas Gursky, Politik II (2020). (Bild: rbr)
Zeit nehmen für die «Zeit»
KUNST Das Thema Zeit ist so zeitlos wie unendlich. Das Zürcher Kunsthaus hat in Zusammenarbeit mit dem Musée international d’horlogerie in La Chaux-de-Fonds eine Ausstellung eingerichtet, die sich der Zeit widmet – von Dürer bis Bonvicini (bis 14. Januar 2024). In sechs Kapitel wird eine Ideengeschichte über Zeit und Zeitgefühl dokumentiert: ein sinnlicher Streifzug durch Zeit und Raum, über biologische, politische, ökumenische und andere Dimensionen.
Wie kann man einem Begriff wie Zeit beikommen? Was assoziieren Sie mit dem Begriff Zeit, was kommt einem spontan in den Sinn? Vielleicht das Ticken einer alten Standuhr, der Glockenschlag am Kirchturm, Charlie Chaplin am Zifferblatt im Film «Modern Times»? In über 100 Begriffen findet man das Wort Zeit – von Auszeit bis Freizeit, von Zeitlupe bis Zeitrechnung oder Zeitreise, Zeitmesser, Zeitdruck, Zeitung, Zeitgeschichte, Lebenszeit, Hochzeit oder auch Herbstzeitlose.
Die Zürcher Ausstellung, konzipiert von Cathérine Hug, präsentiert über 100 Künstler und Künstlerinnen mit rund 250 Werken, Objekten und Installationen. Der Bogen spannt sich von Druckgrafiken eines Albrecht Dürer («Melencolia»,1514) bis zu Kunstwerken wie die gebündelte Weltkugel aus Armbanduhren von Monica Bonvicini («Time of My Life», 2020). Gegenstände, Kunstobjekte, Fotos, bewegte Bilder, Gemälde, Illustrationen, Schiften und mehr. Man kann sich gar nicht genug Zeit nehmen, um sich in die Zeit zu vertiefen. Ein Studium des Katalogwälzers mit über 300 Seiten kann dabei nicht nur hilfreich, sondern auch innovativ sein.
Aufgefächert in sechs Kapitel oder «Zeitzonen», spiegeln Ausstellung und Katalog eine «Bildergeschichte von Zeitbegriffen» wider. Kuratorin Cathérine Hug weiss um die unlösbare Aufgabe, Zeit umfassend darzustellen und in einer Ausstellung zu messen. Gleichwohl sind Hug und ihr Team die Herkulesaufgabe «Zeit» angegangen. «Sogenannte grosse Themen (wie Liebe, Demokratie, Medizin, Mode, Geld oder Künstliche Intelligenz), an die man sich kaum heranwagt und die doch die Eigenart besitzen, uns alle etwas anzugehen, sind immer aktuell», meint Hug. Den Auftakt bilden Zeitphänomene («Deep Time»). Da geht es etwa um die Frage über die Zeit hinaus, um den Ursprung oder auch den Nachthimmel. Wachsen, Gedeihen, Vergehen – die biologische Perspektive beschäftigt uns alle. Die biologische Uhr tickt unaufhaltsam. Christian Giessenbeck zeigt das 1650 mit einer goldenen Tischuhr, auf der der Tod die Zeit angibt. Kapitel 3 widmet sich der messbaren, ökonomischen Perspektive, sprich der Zeitmessung. «Die Uhr, nicht die Dampfmaschine, ist die Schlüsselmaschine des modernen Industriezeitalters», stellt der Kulturhistoriker Lewis Mumford 1834 klar. Wer Uhren liebt, kommt hier voll auf seine Kosten.
Zeit als Richtschnur umfasst den ganzen Globus. Dieser Prozess begann 1884, als man sich auf den Nullmeridian in Greenwich einigte: die politische Dimension. Zeiten mussten aufeinander abgestimmt werden (Zeitzonen) – nicht nur für Eisenbahn- und Flugpläne. Als Illustration seien Jean Dubuffets Riesengemälde «Le Train de pendules» (1965) oder Monicas Bonvicinis Skulpturen «You to Me» (Handschellen an einer Kette, 2020) erwähnt,
Das Kapitel «The Information Superhighway» nimmt Medien aufs Korn, die Verbreitung von Nachrichten, Meinungen, Stories. Eine Reihe von Titelseiten «Newsweek» werden aufgereiht, ein 17-teiliger Digitaldruck von Alfredo Jaar aus dem Jahr 1994 oder Herlinde Koelbls Fotoserie «Angela Merkel» (1991–2021). Das Magazin «Time» oder die Wochenzeitung «Zeit» sind kein Thema. Warum eigentlich nicht?
Die Ausstellung schliesst mit der «Eigenzeit», wobei die Aspekte «Schlaf, die soziale Konvention der Ferien und die Sichtbarkeit von Zeit im Produktionsprozess des Kunstwerks selbst» in den Fokus gerückt werden. Als Beispiele dienen etwa Albert Ankers Gemälde «Zwei schlafende Mädchen auf der Ofenbank» (1895), Jos Näpflins Installation «Zeit ist zeitlos» (2019) oder Ai Weiweis «Handschellen» (2015).
Man kann sich praktisch oder philosophisch, wissenschaftlich oder fantastisch mit der Zeit, dem Leben, beschäftigen, kann eintauchen, bilanzieren, philosophieren. «Carpe diem», sagt der Lateiner, sprich: Pack dir den Tag, die Zeit. «Zeit ist Geld», mahnen die Materialisten. Zeit kann man nicht kaufen, nur erleben. Die Zeit rennt davon, lautet ein gängiger Spruch. Zeit ist eine Erfindung der Menschen, eine Orientierung, eine Richtlinie, ein Massstab – egal ob auf Reisen (Fahrpläne!). Die Zürcher Ausstellung veranschaulicht dieses Thema auf vielfältige Weise, natürlich mit Lücken (wo ist Chaplins legendäre Zifferblattaktion?). Anregend. Eine Gelegenheit auch, unser Zeitverhalten zu prüfen, zu hinterfragen. Technik mag sie stoppen, zerdehnen (Zeitlupe, Zeitraffer), wir sind gleichwohl der Zeit ausgeliefert.
«Zeit. Von Dürer bis Bonvicini», Zürcher Kunsthaus bis 14. Januar 2024. Katalog mit englischen Übersetzungen, 49 Franken
Filmprogramm zur Ausstellung im Arthouse Kino Piccadilly, Zürich, jeweils sonntags 11 Uhr:
5. November «Memoria» (Thailand 2021)
26. November «Unrueh» (Schweiz 2022)
17. Dezember «Le prince» (Deutschland 2021)
7. Januar «The Hummingbird Project» (USA 2019)
4. Februar «Jeanne Dielman» (Belgien 1975).
filmingo, die Schweizer Streaming-Plattform für Arthouse-Filme, hat zum Thema «Zeit gestalten» eine Auswahl von Filmen zusammengestellt, die zu Zeitreisen einladen.
Veröffentlicht Oktober 2023
Amazônia» – Fotos als Mahnung – wie gemalt
KUNST Es ist noch nicht zu spät: Die Fotoausstellung Amazônia zeigt in der Zürcher Maag Halle die atemberaubenden Schwarzweissbilder des Fotographen Sebastião Salgado, Umweltschützer und Umweltaktivist. Der Brasilianer und seine Frau Lélia Wanick kämpfen seit Jahrzehnten für Menschen und Umwelt in Amazonien.
Die Schwarzweissbilder sprechen für sich – in der Maag Halle Zürich. Grossformatig und sanft beleuchtet. Sie wirken wie Gemälde. Gerhard Richter (siehe «Landschaften» im Kunsthaus Zürich, 2021) könnte sie nicht besser kreieren. Wolken und Wasser türmen sich, verschmelzen. Flussläufe durchschneiden wie ein Schlangenband die Regenwälder. Baumwipfel werden zu bizarren Skulpturen und Mustern. Wolken und Wasser türmen sich, verschmelzen. Flussläufe durchschneiden wie ein Schlangenband die Regenwälder. Baumwipfel werden zu bizarren Skulpturen und Mustern. Fluss- und Insellandschaften muten wie Labyrinthe an. Wenn Fotographien rein formal fesseln und magisch anziehen, dann sind es die Arbeiten des Brasilianers Sebastião Salgado. Rund 200 seiner Fotobilder sind in der Maag Halle Zürich zu sehen. Sie touren um die Welt und haben einen wichtigen Zweck: Sie wollen Natur und Menschen im Amazonas-Gebiet nicht nur dokumentieren, sondern auch schützen.
Salgado und seine Frau, die all seine Bücher publiziert, mit der er seit 1967 Jahren verheiratet ist, haben den grössten Regenwald der Welt und die Gefährdung durch Raubbau (Abholzung) bekannt. Sie sind mit gutem Beispiel vorangegangen, haben die elterliche Farm Bulcão wieder aufgeforstet und saniert mit zweieinhalb Millionen Bäumen. Das gesundete Gelände haben die beiden dem Staat als Nationalpark geschenkt. Auch das dokumentiert die Ausstellung «Amazônia».
Aber es sind nicht nur Natur und Landschaften, die hier eindrücklich in den Blick gerückt werden, sondern auch die Menschen, die dort leben fern ab der Zivilisation. Sie, die zahllosen Indigenen Völker und Stämme sind ebenso existentiell gefährdet wie ihr Lebensraum. Sie sind wichtiger Teil dieser Umweltdemonstration. Sie (die Texttafel) beschreiben Lebensart, Rituale, Traditionen, Gemeinschaft. Packende Bilder trotz mancher Pose ungeschminkt, nah und mahnend. Das Buch «Amazônia» haben die Salgados den Menschen der brasilianischen Amazonas-Region gewidmet. «Eine Feier des Überlebens ihrer Kultur, Sitten und Sprachen. Es sei ebenso ein Tribut für ihre Rolle als Wächter der Schönheit, der natürlichen Ressourcen und der Biodiversität des grössten Regenwaldgebiets des Planeten angesichts der unverminderten und unerbittlichen Zugriffe und Eingriffe der Aussenwelt», unterstreichen die beiden Umweltkünstler im Vorwort.
Buchauswahl
Sebastião Salgado und Lélia Wanik Salgado
«Amazônia», Grossformat gebunden 128 Fr.,
Ausgabe Kulturmagazin DU Nr. 908, 20 Fr.,
Taschenbuch, Verlag Taschen 2022, 19.90 Fr.
«Genesis», Buch, 75.00 Fr., Taschenbuch 19.90 Fr.
«Afrika», Taschen Verlag, Köln 2007, 78.00 Fr.
Veröffentlicht September 2023
Links: Salvador Dalí, «Femme à tête de roses» (1935), Kunsthaus Zürich, 1957.
Oben: Alberto Giacometti, «Mannequin» (1932/33) in: Giacometti – Dalí. Traumgärten, Ausstellungsansicht Kunsthaus Zürich, 2023, Foto: Franca Candrian.
Laboratorium der Surrealisten
Giacometti – Dalí
KUNST Im Zentrum der aktuellen Ausstellung im Kunsthaus stehen zwei Künstler, die in den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts eng zusammengearbeitet haben: Der Bündner Alberto Giacometti und der Spanier Salvador Dalí fanden sich zu einer «surrealistischen Kooperation». Sie entwarfen einen «Traumgarten» (Projet pour une place), der freilich Stückwerk und Vision blieb: «Giacometti – Dali. Traumgärten». «Gärten sind – wie Museen – Orte der Inspiration, der Erholung, der Alltagsflucht», schreibt die Kunsthausdirektorin Ann Demeester, im Grusswort. «In der Ausstellung Giacometti – Dalí. Traumgärten beleuchtet das Kunsthaus Zürich die Freundschaft der beiden Künstler und ihre gemeinsame Erkundung von Träumen und von geträumten Räumen – von Traumgärten.»
Konkreter Ausgangspunkt war ein Auftrag des französischen Sammlerpaars Marie-Laure und Charles de Noailles für einen Park ihres Sommersitzes in Hyères. Giacometti entwarf 1929 eine von drei Figuren für das Gartenprojekt. Er stellte sich ein Ensemble geometrischer Figuren vor. Das ganze Projekt wurde indes nie realisiert. Aber die Idee faszinierte, lag sie doch ganz im Trend der modernen Gartenkunst im Frankreich der Dreissigerjahre. «Eine geometrische, regelmässige Gestaltung, die Dominanz des Mineralischen über das Pflanzliche und der Einsatz neuer Materialien und Technologien wie Stahlbeton oder Elektrizität sind für sie charakteristisch,» schreibt Camille Lesquef in ihrem Essay «Moderne Gartenkunst in Frankreich: Kreuzung und Hybride».
Doch nicht die Gartenkunst an sich, sondern die künstlerische Freundschaft, geistige Verbundenheit und surrealistische Verwandtschaft stehen im Zentrum der Kunsthaus-Ausstellung. Salvatore Dalí hatte in Giacometti einen Künstler entdeckt, der ausgezeichnet in die Gruppe der Surrealisten passte. Er animierte ihn, der Gruppe in Paris beizutreten. Giacometti wurde dann aber 1935 infolge Kontroversen ausgeschlossen. Ausgangspunkt Annäherung war Giacomettis Werk «Boule suspendue» (1930), eine Metapher für erotischer Begierde, in Paris ausgestellt. Die Grundidee: Die Welt menschlicher Psyche sollte Ausdruck in der Kunst finden.
Dieses Objekt wie auch zahlreiche Skulpturen, Skizzen, Gemälde, Briefe, Fotos, Illustrationen und Installationen sind in der Ausstellung zu entdecken. So ist auch die imaginierte Garten-Installation, die aus Stein geplant war, hier nun als Modell im Massstab 1:1 präsent.
Beide Künstler waren auf ihre Art Pioniere. Giacometti beispielsweise hatte früh dafür plädiert, nicht nur Figuren zu präsentieren, sondern zu Leben und Begehen einzuladen. Er schrieb in einem Brief über das Modell für eine grosse Skulptur in einem Garten: «Ich wollte, dass man die Skulptur begehen, sich auf sie setzen und sich abstützen kann.» Dalí schwebte eine Art Vergnügungspark vor, «der auf Erfüllung von Wünschen beruht – den Wünschen zu gehen, zu klettern, zu sitzen, in Löcher zu passen, die uns niemals angeboten werden, weder in der Realität noch in der Kunst, Produkt des rationalisierten Geistes, Architektur oder Attraktionen, basierend nur auf Phantasien und unbewussten Vorstellungen, sie werden das Gefühl der Rückkehr betäuben, Attraktion des intrauterinen Lebens – imaginiert, um farblos ausgearbeitet zu werden, weiss getünchter Gips», beschriftete Dalí die Zeichnung «Fun Fair um 1932 (auch dieses Dokument ist hier ausgestellt).
Die Werkstattschau rund um das erwähnte Gartenprojekt, von der Pariser Fondation Giacometti konzipiert und erweitert, eröffnet neue Perspektiven und Entdeckungen im Kleinen wie im Grossen, auch was die Aspekte Modelle und Mannequins angeht. Anschaulich ist das mit der Gegenüberstellung von Giacomettis «Mannequin» (1932/33) und Dalí «Frau mit Rosenhaupt» (1935) zu erleben.
Die kompakte Ausstellung – ein künstlerischer Dialog – bereichert und lädt in ein «Laboratorium und offene Werkstatt der Kunst» ein, so Kurator Philipp Büttner bei der Presseorientierung, Sie ermöglicht spannende Rück- und Einblicke in die surrealistische Haltung und Welt der Dreissigerjahre des letzten Jahrhunderts.
Giacometti – Dalí. Traumgärten, Kunsthaus Zürich bis 2. Juli 2023.
Das 200 Seiten starke Buch zur Ausstellung wurde von der Fondation Giacometti herausgegeben, Fage Editions, 39 Franken. Unter anderem sind Beiträge zu folgenden Themen detailliert illustriert und analysiert: «Die Begegnung. Das surrealistische Milieu und die Noailles», «Echo der Begierde», «Traumgärten», «Projet pour un Passage: 1930/31» oder «Surrealistische Kameradschaft».
Veröffentlicht April 2023.
«Kann denn Liebe Sünde sein …?»
Die Schwedin Zarah Leander, bürgerlich Sara Stina Hülphers (1907–1981), startete Ende der Zwanzigerjahre als Revuesängerin und erlebte ihren Durchbruch 1936 in Wien. Parallel zu ihren Bühnenauftritten drehte sie ihren ersten Film «Premiere» von Géza von Bolváry. Zum gefeierten Film- und Gesangsstar wurde sie während des Naziregimes in Deutschland. Dieser «Zarah» hat Georg Kling eine konzertante Inszenierung gewidmet mit dem Untertitel «Einmal Zirkuspferd, immer Zirkuspferd», einem Zarah-Leander-Zitat. Er schildert das Leben einer Frau, die vom braven Mädchen aus der schwedischen Provinz zur Revue- und Leinwanddiva aufstieg, dabei zur hemmungslosen Opportunistin wurde und sich vor den Propaganda-Karren eines Goebbels und Hitlers spannen liess. Gleichwohl schob sie den Avancen des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda Joseph Goebbels einen Riegel vor und liess sich nicht vom Nazi-Minister ins Bett zerren.
Diese geradezu höllisch-himmlische Karriere führt Georg Kling in seiner Einmann-Show vor – grandios als Moderator und Kommentator, Sänger und Performer. Er imitiert und parodiert nicht, sondern interpretiert auf seine Weise Lieder wie «Ich steh’ im Regen» oder «Davon geht die Welt nicht unter», treffend im Gestus und der Bewegung. Andere Zarah-Evergreens wie «Der Wind hat mir ein Lied erzählt» aus dem Melodrama «La Habanera» oder «Ich weiss es wird einmal ein Wunder geschehen», ein Hoffnungslied, das auch in KZs erklang, werden filmisch eingespielt oder vom Künstler Kling beseelt interpretiert.
Klings «Zarah»-Schau ist einerseits Huldigung einer einmaligen Diseuse, andererseits die kritische Beleuchtung einer opportunistischen Karriere. Dabei kommen auch die nicht zu kurz, die Zarah Leander erst als Sängerin berühmt gemacht haben, etwa die Liedermacher Michael Jary, Bruno Balz oder Ralph Benatzky. Diese packende Reminiszenz an eine kontrastreiche Künstlerin mit dunklen Seiten, die gegen Ende ihrer Karriere zur Schwulen-Ikone wurde (etwa mit dem Lied «Kann denn Liebe Sünde sein»?»), fasziniert und stimmt nachdenklich.
«Zarah», eine Show mit Georg Kling
Nächste Aufführungen am 30. März im Musikhaus, Zweisimmen,
und am 21. September im Theater Uri, Altdorf
Veröffentlicht Januar 2023.
Frauen faszinierten ihn: Gustav Klimts Bilder sind erotische Sinnbilder. (rbr)
«Klimt’s Kuss – Spiel mit dem Feuer» – Sinnliche Reise
Nach dem grossen Besuchererfolg mit «Monet’s Immersive Garden» wartet die Lichthalle Maag in Zürich mit der Installation «Klimts Kuss – Spiel mit dem Feuer» auf (bis 7. Mai 2023). 40 Projektoren lassen Leben und Werk des Wiener Künstlers Gustav Klimt 1862–1918) aufflammen. Ein sinnliches Sehereignis mit Klimts berühmtestem Bild im Zentrum: «Der Kuss» (1907/08).Er war kein Mann der grossen Worte, schon gar kein Selbstdarsteller. Es existieren keine Selbstporträts wie bei vielen Malern, nur einige Fotografien, wenige schriftliche Zeugnisse und ein Porträt des Zeitgenossen Egon Schiele. Der Wiener Maler Gustav Klimt war publikumsscheu, er kommentierte seine Werke nicht: «Ein Künstler spricht aus seinen Bildern, Worte sind überflüssig.» Und die regten Fantasie und Diskussionen an, erst recht zu seiner Zeit, dem Jugendstil und Fin de Siècle.
Nun darf man von der spektakulären Multivision in der Zürcher Lichthalle Maag keinen kunsthistorischen Exkurs oder die absolute Interpretation des stilbildenden österreichischen Malergenies erwarten, wohl aber packende Einblicke in Klimts Welt und Werk. Und das beginnt mit einer Künstlerchronologie vom Elternhaus in Wien (1862) bis zu seinem Tod 1918 infolge eines Schlaganfalls. Auffallend sind dabei seine zahlreichen Verbindungen und Liebschaften zu Frauen – Klimt hatte sechs (ehelose) Kinder mit drei verschiedenen Frauen (und Modellen). Seine Bilder erregten Aufsehen, besonders seine Frauenporträts, Akte, Paarungs- und Liebesszenen, beispielsweise beim «Beethoven-Fries» (1902). Zentrales Thema des Frieses, der sich auf den Schlusschor von Beethovens «9. Symphonie», die Vertonung der Ode «An die Freude» von Friedrich Schiller, bezieht, soll gemäss Ausstellungskatalog die Erlösung der «schwachen Menschheit» durch die Kunst und die Liebe darstellen. Ausschnitte aus dem Fries werden in der Multivision mit entsprechendem «Freude»-Chor untermalt.
Gleich zu Beginn der Schau in der Maaghalle begegnet man der allegorischen Komposition «Wasserschlange II» (1904–1907) und «Wassernymphen». Eine fiktive Begegnung begleitet die Besucher: Eine Studentin spricht im Off mit der Modeschöpferin Emilie Flöge (1874–1952), die Klimt ein Leben lang begleitet und gefördert hat. Eine echte Lebensgefährtin, Vertraute und Muse, unverheiratet und kinderlos. Die Ausstellung gliedert sich in verschiedene Abschnitte, die Themen wie «Emilie», «Nackte Wahrheit», Sinnlichkeit und Erotik, Landschaften und mehr gewidmet sind. Man kann sich einsehen und von den impressionistischen, ornamentalen oder monumentalen Projektionen berauschen lassen. Insgesamt stehen 40 Projektoren im Einsatz, die Wände, Decken und Böden beleben: Ornamente schweben. Frauenporträts, «Judith» oder «Salome» beispielsweise, ziehen vorbei, Lebensstationen, das Wiener Secessionsgebäude (1897–98), Ausstellungsräume, Zeitgenossen passieren Revue.
Natürlich nimmt Klimts wohl berühmtestes Gemälde «Der Kuss» (1907/08), welches der Ausstellung den Titel gab, breiten Raum ein – en Detail und im Gesamten. Ob tatsächlich Klimt selbst und Gefährtin Emilie tatsächlich als Vorbilder dienten, ist eher fragwürdig und bleibt Spekulation. Das Bild wurde zum Kommerztopos, hat weltweit verschiedenste Formen angenommen, dient für Reproduktion auf Tassen und Tüchern, Tapeten und Kacheln, Poster oder Hinterglasbilder.
«Die Aura des Bildes», schreibt Gottfried Fliedl in seinem Buch über Gustav Klimt, «und seine verführerische Schönheit beruhen sowohl auf seiner – doppeldeutigen – Kostbarkeit wie auf der Darstellung des Liebespaares als Inbegriff des ungetrübten erotischen Glücks.» Ein traumatischer Akt, der Welt enthoben, isoliert verschmolzen. Im Sinne der Ideologie des Jugendstils werde das Paar als «Allheitliches, Kosmologisches und Naturverbundenenes» geschildert (Jost Hermand «Der Schein des schönen Lebens». Studien zur Jahrhundertwende, 1972).
Gustav Klimt huldigte Frauen, verinnerlichte sie. «Das gesamte Werk Klimts ist eine Huldigung an das Matriarchat, das die Moderne beherrscht», urteilt Jacques Le Rider in seinem Beitrag «Modernismus/Feminismus» (1985). Sicher hat er mit seinen Gemälden und Zeichnungen dazu beigetragen die Kraft des Erotischen zu entstauben und zu stärken. Sein Werk habe sich auf das im Umbruch befindliche Bild der Geschlechter und auf die reale, gesellschaftliche Veränderung der Geschlechterbeziehung bezogen, schreibt Gottfried Fliedl in seinem grossformatigen, reich illustrierten Band über Klimt.
Grob betrachtet, kann man Klimts Werke in drei Sparten aufteilen: Frauenporträts, allegorische Arbeiten (Friese u.a.), Menschenbilder («Baby», «Tod und Leben» u.a.). So lädt die immersiven Inszenierung «Klimts Kuss» zu einer intensiven Erlebnisreise und bietet Reiz zur Vertiefung.
Empfehlenswerte Lektüre:
Gottfried Fiedl «Gustav Klimt 1862–1918. Die Welt in weiblicher Gestalt», Benedikt Taschen Verlag 1991. Grossformat, 240 Seiten.
Tobias G. Natter (Herausgeber) «Gustav Klimt». Sämtliche Gemälde. Sechs Kapitel verschiedener Autoren von «Der Salonmaler: Frühe Werke – frühe Karriere» über «Frauendarstellungen» bis «Die Landschaften: Eine re-konstruierte Natur» und Biografie. Taschen Bibliotheca Universalis, Köln 2022, 29.90 Franken. Reich illustriert, 510 Seiten.
Veröffentlicht Dezember 2022
Frauen – Alte Liebe rostet nicht!
FILM Comic-Verfilmungen und starke weibliche Black Power liegen im Trend, Actionspektakel wie «The Woman King» oder «Black Panther: Wakanda Forever» lassen die Kassen klingeln. Spektakuläre Fantasy und Kinovisionen eben. Realität ist etwas anderes, besonders aus weiblicher Sicht. Es fällt auf, dass Frauen stärker dominieren als auch. Oft wird über fehlende Frauenquoten gejammert und lamentiert, vor allem im Wirtschafts- und Politikbereich. Auffallend, im Kino rücken Frauen stärken in den Fokus – im Vorder- und Hintergrund, vor und hinter der Kamera. Das ist gut so. Bemerkenswert auch, dass reifere Schauspielerinnen einige aktuelle Filme akzentuieren. Iris Berben hat als Patronin den Familienclinch «Der Vorname» angeschoben und trägt beim Nachfolgefilm «Der Nachname» wesentlich zum intelligent-witzigen Gefühlsfight auf Lanzarote bei. Dabei sollte es ein harmonisches Familientreffen werden, an dem die Patronin ihre eheliche Liaison offenbaren und um Verständnis buhlen wollte. Das unterhaltsame Sequel könnte durchaus einen dritten Teil animieren, vielleicht unter dem Titel «Der Kosename». Kann ja noch werden.
Familienknatsch sind eine Sache, die Liebe eine andere. Da sollte man sich mal «AEIOU – Das schnelle Alphabet der Liebe» ansehen – mit einer unwiderstehlichen Sophie Rois (61), das Lustspiel «Good Luck to You, Leo Grande» mit einer prickelnden Emma Thompson (63) oder das Beziehungsdrama «Les jeunes amants» mit einer verletzlichen Fanny Ardant (73). In all diesen Filme stehen Frauen im Fokus, notabene reifere, die es nochmals wissen wollen. Ehrlich, ungeschminkt und faszinierend. Man kann auch Esther Gemsch (66) dazuzählen, die sich auf einer Kreuzfahrt freischwimmt und «Die goldenen Jahre» selber animiert. Die flotte Beziehungskomödie avancierte übrigens zum erfolgreichsten Schweizer Film 2022 – bis dato. Und das in diesen trüben Krisenzeiten!
Kein Trübsal blasen die mittdreissiger Frauen um die Ostberlinerin Karoline Herfurt (38), die nach «Wunderschön», 2020 fertiggestellt, aber infolge Corona erst 2022 gestartet, mit «Einfach mal was Schönes» (Bild links, 2022) nachlegt – wieder mit der reizvoll kratzigen Nora Tschirner. Frauen in der Krise: Karla (Herfurth) will unbedingt noch ein Kind vor dem 40. Geburtstag, wenn’s sein muss auch ohne Mann. Doch ihre Schwestern (Nora Tschirner und Milena Tscharntke) sind dagegen. Und dann schiesst Amor auch noch einen Pfeil ab. Schön sein ist nicht alles, aber kann glücklich und Lust machen.
Eine kleine wunderbare Entdeckung ist die Pariser Tour «Une belle course» (Bild rechts). Taxifahrer Charly (Dany Boon) knabbert an Problemen, vor allem finanziellen. Dann nimmt er fast widerwillig eine Fuhre an: Er soll die 92jährige Madeleine (Line Renaud, 94) an ihr neues Heim, eine Seniorenresidenz, chauffieren. Diese Fahrt wird zu einem Lebensrückblick für die alte Dame und gibt dem unglücklichen Taxifahrer neuen Lebensmut. Solche Filme machen nicht nur Hoffnung, sondern auch ein bisschen glücklich. Der Spruch «Alte Liebe rostet nicht» gilt erst recht fürs Kino – auch mit Alten für Junge und Jüngere!
Veröffentlicht November 2022
Fokus auf das Fremde
FILM Im November sind gleich zwei ausserordentliche Filmfestivals in der Schweiz angesagt: Die 28. Internationalen Kurzfilmtage in Winterthur (8. bis 13. November) und das 6. Arab Film Festival in Zürich (17. bis 17. November 2022). Beide wollen den Filmhorizont erweitern, den Blick auf fremde Länder und Menschen schärfen und bereichern.
Das Augenmerk der 26. Internationalen Kurzfilmtage 2022 liegt auf Südamerika (Argentinien, Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru und Venezuela) sowie Israel. Für zehn Programmblöcke im Schweizer und Internationalen Wettbewerb wurden 55 Kurzfilme ausgesucht. Das Spektrum ist breit. Erwähnt seien nur «Der Molchkongress» von Matthias, Sahli und Immanuel Esser, dessen Drehbuch in einer szenischen Lesung präsentiert wird, Jorge Cadenas neustes Werk «Flores del otro patio» (Bild, Kolumbien), «Il Muratore» von Matteo Gariglio oder «Amok» von Balázs Turai. Es gibt viel zu entdecken.
In einer einmaligen Performance präsentiert der Schweizer Hannes Schüpbach zusammen mit dem Cellisten Flurin Cuonz und Werner von Mutzenbach zwei Videoprojekte.
Erstmals ziehen die Kurzfilmtage aufs Sulzerareal ins Kino. Zu Camio, oxyd Künsträume und Alte Kaserne stossen das blue Cinema Maxx, das Kulturlokal Kraftfeld und das Museum Schaffen dazu. Erstmals werden in diesem Jahr alle Filmprogramme in Maxx-Kinosälen gezeigt.
Auskünfte: media@kurzfilmtage.ch
https://www.kurzfilmtage.ch/de/programm
Zum sechsten Mal findet im Züricher Filmpodium das Arab Film Festival Zurich statt. Nicole Reinhard, neue Direktorin des Filmpodiums, hat die Leitung übernommen und will an den Grundsätzen festhalte: Präsentation des Filmschaffens arabischer Länder und kultureller Austausch. Im Fokus stehen die Länder Jordanien und Libanon. Auch Saudi-Arabien ist vertreten, wo das Kino überhaupt jüngst erst zugelassen wurde. Filme aus 22 Ländern wurden programmiert. Der saudische Filmemacher Mohammed Alholayyil erzählt in seiner Tragikomödie «40 Years and One Night» von einer Familie, die in eine Krise stürzt. Der Ägypter Mohamed Diab stellt den palästinensischen Teenager «Amira» in den Mittelpunkt, der seinen biologischen Vater sucht. In «Big Little Women» schildert die ägyptisch-schweizerische Autorin Nadia Fares, wie drei Generation Frauen gegen das Patriarchat in Ägypten rebellieren. Der Tunesier Néjib Belkadhi beschreibt in «Communion» das Leben unter Lockdown. Dima El-Horr aus dem Libanon blickt mit ihrem Film «Conversations With Siro» auf die Katastrophe im Hafen von Beirut 2020 zurück, sprach mit der armenischen Künstlerin Siro und schuf das Bild eines sterbenden Libanon.
Dies nur ein kleiner Programmausschnitt aus dem Arab Film Festival Zurich das alle zwei Jahre organisiert wird. Alle Filme, 18 Lang- und 25 Kurzfilme, werden im Filmpodium aufgeführt.
Informationen: https://www.iaffz.com/de/
https://www.filmpodium.ch/reihen-uebersicht/57915/6th-arab-film-festival-zurich
Veröffentlicht Oktober 2022
Ohne «Hemmige» zügig voran
THEATER «Trams und Busse sind die fahrende Demokratie für alle», meint Dichter und Stückeschreiber Franz Hohler. Und so hat er flugs Szenen vor und auf den Gleisen verdichtet. Daniel Rohr und Klaus Hemmerle haben sie fürs Bernhard Theater inszeniert: «ÖV» (bis 16. Oktober 2022).
Wer kennt das nicht aus eigener Erfahrung: Plätze tauschen, Störungen in der Ruhezone oder Warten am Gleis! Manche Fahrgäste haben eben keine «Hemmige» (wie Mani Matter einst vortrug) dem Sitznachbar einen Platzwechsel schmackhaft zu machen (wegen der Fahrtrichtung) oder einen Gegenüber in ein Gespräch zu verwickeln, obwohl der Mitfahrende gern lesen oder sich in seinen Laptop vertiefen würde. «Es sitzed all im gliche Zug», singen Beteiligte (nach Dusti Pollak), aber das Verhalten ist eben nicht «glich» und nicht immer rücksichtsvoll.
Büne Hubers (Patent Ochsner) Lied «Dr Zuug fahrt us de Stadt«» stimmte ein und Polo Hofer sinnierte über «S’letschte Tram». Dieses wunderbar melancholische Lied ging etwas unter bei der sonst tadellosen Leistung des Bernhard-Ensembles. Die Alltagsszenen wurde akzentuiert durch Lieder von Mani Matter und Jacob Stickelberger, Polo Hofer und Franz Hohler («S’Tram uf Afrika»). «ÖV», ein Theaterstück mit Musik, ist eine Eigenproduktion des Bernhard Theaters, das eine echte Durststrecke hinter sich hat – infolge der Pandemie (Reduktion der Plätze etc.). Man, das heisst Direktorin Hanna Scheuring und ihr Team, hat nicht verzagt, hat nicht lockergelassen und die Eigenproduktion wieder belebt. Und nun sind sie wieder mit Herz und Stimme bei der Sache: Graziella Rossi, Kamil Krejči, Markus Keller, Delio Malär, Rolf Sommer und Hanna Scheuring. Ursprünglich war die «ÖV»-Inszenierung fürs Theater Rigiblick in Zürich vorgesehen. Nun ist sie im Bernhard Theater heimisch geworden. Ein gelungener Episodenreigen: Alltägliches gleitet ins Absurde, Zwischenmenschliches wird zur Offenbarung, und der Humor feiert fröhlich Urständ (bis 16. Oktober in Zürich).
ÖV im Bernhard Theater, Zürich
Veröffentlicht Oktober 2022
Sie ist eine fesselnde Erzählerin und Filmerin. Doris Dörrie («Männer») beschreibt in ihren letzten Büchern Inspirationen aus der Küche und die Reiseerfahrungen einer «Heldin» in San Francesco, Tokio und Marrakesch – genussvoll genüsslich. (Bilder: Diogenes)
Doris Dörrie – Heldin zwischen Teller und Tokio
BÜCHER Doris Dörrie, 1955 in Hannover geboren, hat sich nicht nur einen Namen als couragierte Filmerin gemacht – von «Männer» (1985) über «Kirschblüten – Hanami» (2008) bis «Kirschblüten & Dämonen» (2019) und aktuell «Freibad», sondern auch als Autorin. Sie ist Professorin für Angewandte Dramaturgie und Stoffentwicklung in München (seit 1997), Gründungsmitglied der Deutschen Filmakademie, Film- und Opernregisseurin. Will man ihren letzten beiden Büchern glauben, ist sie ein ausgeprägter Kultur- und Genussmensch. Davon legen einerseits ihre Inspirationen aus der Küche («Die Welt auf dem Teller», Diogenes 2020) Zeugnis ab, andererseits ihre «autofiktionalen Texte» in ihrem Reisebuch «Die Heldin reist» (Diogenes 2022).
Darin erzählt sie von drei Stationen, die ihr Leben mitgeprägt haben: San Francesco, Tokio und Marrakesch. Ihre Ausgangsfrage: Kann eine Frau überhaupt Heldin sein, kann sie sich von den Klischees befreien, ist frau überhaupt zu einer «Heldenreise» fähig? «Der Held muss aus dem Haus, um ein Held zu werden. Und die Heldin? Sie ist gar keine Heldin, sondern die Frau des Helden, sie bleibt, wo sie ist, und beschützt das Haus. Sie ist die Hausfrau, die Frau im Haus. Sie muss auch deshalb dableiben, damit jemand zu Hause ist, wenn der siegreiche Held zurückkehrt. Sie darf nicht ausziehen, um das Fürchten zu lernen, aber das muss sie auch gar nicht, denn sie hat ja sowieso permanent Angst …» Doris Dörrie hat notabene keine Angst und erkundet die Welt, zum Beispiel in Kalifornien, vor allem aber in ihrem Lieblingsland Japan. Sie gibt akribisch Einblicke ins japanische Wesen, in Gewohnheiten und Kultur, beispielsweise in die Welt der ama, der Taucherinnen ohne Sauerstoffgeräte. Man lernt Tatsu kennen, eine japanische Freundin aus Kyoto und deren Sicht auf Frauen, auf Deutschland, auf Dörries Film «Mitten im Herz» (1983).
Am Ende der Reise gesteht Dörrie sich ein: «Ich habe keinen Kampf geführt, nicht dem Drachen ins Auge gesehen, sondern er nur mir. Ich bin keine Heldin, ich bin nur gereist. Ohne Not, ohne dringenden Anlass. Ich bin nicht ausgezogen, um das Fürchten zu lernen …Endlich schlafe ich ein. Im Traum vollbringe ich Heldinnentaten. Ich bin unterwegs, auf einer langen, weiten Reise in eine abenteuerliche Geschichte.» Spannend und schmackhaft – egal ob auf der Leinwand oder zwischen Buchdeckeln.
Doris Dörrie «Die Heldin reist», Diogenes Verlag, Zürich 2022, 30 Franken
Doris Dörrie «Die Welt auf dem Teller», Diogenes Verlag, Zürich 2020, 30 Franken
Veröffentlicht August 2022
Kunst auf der Strasse: Irma Bucher posiert neben ihrer Skulptur,
Dada-Künstler und Mitorganisator Renato Wellenzohn führt gelegentlich durch die Biennale 2022. (Bilder: rbr)
BIENNALE 2022 IN WALDENBURG Zum zweiten Mal nach 2020 wird Waldenburg, das Städtchen im Frenkental, zum Entdeckungsparcours der Kunst. 45 Kunstschaffende haben an über 100 Standorten ihre Werke platziert – von «Medusa in the Sky» übers «Schellenursli»-Skelett und «Fischfrau» bis zur «Schäferin und drei Schafen». Der mittelalterliche Flecken in Baselland wurde mit Kunst belebt, lädt zum Wundern, Verweilen und Phantasieren ein (bis 29. Oktober). Das ganze Frenkental scheint eine Baustelle. Schmalspurbahn und der Waldenburger Bahnhof werden saniert, modernisiert. Das hat bekanntlich mit Engpässen, Slalomfahrten und Baustellengetöse zu tun. Hat man diesen Parcours mit dem Auto bewältigt (Verkehrsverbindung sonst von Liestal nur mit dem Bus), ist das Ziel erreicht (Parkplatz beim Schulhaus und Gemeindehaus).
Just vis-à-vis am Bach lockt das «Hockende Weib» von Lucia Strub (Belgien). Frauen sind stark präsent. Ein Drittel der Kunstschaffenden seien weiblich, bestätigt uns Organisator und Kommunikator Renato Wellenzohn, der selber auch künstlerisch präsent ist. War es vor zwei Jahren seine Popfigur «Hello Kitty», welches Aufsehen erregte und starkes Kaufinteresse fand, ist es heuer sein «Schellenursli», der, zum Skelett abgemagert, sich über das Endes seines Jobs als Wintervertreiber zu Tode gegrämt haben soll, auch weil die Treichler vom Unterland seine Funktion politisch unterlaufen haben. Chalandamarz, einer der berühmten Engadiner Bräuche, mit eben diesem Schellenursli ist auch anders im Gespräch, weil er bisher nur Buben vorbehalten ist.
Verschmitzt und witzig wie immer ist der bekennende Dadaist und eingefleischte Rolling Stones-Fan Wellenzohn auch belebender Kunstführer (jeweils am letzten Sonntag im Monat ab 14 Uhr). Er kennt die Geschichten hinter Werken etwa bei der Frau «Living in the Square» oder beim Spucker am Turm von Marck (ZH), einer Installation im Stadttor. Er kann etwas über die Figur «Gravitation» am Kirchturm (ehemaliges Kornhaus) von Rolf Sprecher (AR) erzählen. Man kann «Maaagda + Maaagret + Maaathilda» von Larry McLaughlin (USA) kennenlernen oder an «La pirogue» von Giorgi (Frankreich) herumrätseln. Wer aufmerksam ist, wird einen kleinen Mamorkopf auf einer Mauer von Irma Bucher (BL) entdecken. Und wenn man Glück hat, begegnet man Renato Wellenzohn himself auch ausserhalb einer Führung und dem «Men’s Dream» vor seiner Haustür. Der Insider ist in Waldenburg seit 2017 ansässig, umtriebig wie eh und je, und hat zusammen mit Sibylla Dreszigacker (BL) und Pt Whitfield (BL) die Biennale in Baselland ins Leben gerufen und betreut.
Dieses einzigartige Kunstpanoptikum frei Haus liegt im Abseits der grossen Kulturpfade, fast im Verborgenen. Eine Reise zu den Skulpturen, Figuren, Installationen und Anstössen wird mit Entdeckungen belohnt.
Ville des Artes, Waldenburg BL bis 29. Oktober.
Führungen jeden letzten Sonntag im Monat ab 14 Uhr beim Kiosk mit Renato Wellenzohn.
Anmeldung: e-well@bluewin.ch
Künstler und Preisliste: http://www.villedesarts.ch/preise_ville_2022.html
Veröffentlicht Juli 2022
Der Filmschöpfer Federico Fellini hat von Beginn an seine Finger im Spiel. Vor dem Film sind Skizzen, Zeichnungen, Karikaturen angesagt. Erkennen Sie den Schwerenöter Casanova? (Bilder: ZVg)
Aufgeblättert und aufgezeichnet
KUNSTHAUS ZÜRICH Es ist eher ungewöhnlich, dass ein Filmregisseur in einem Kunsthaus aufgenommen wird. Filmschöpfer Federico Fellini hatte seit Beginn eine Affinität zur Film-Kunst. Seine Filme entstanden im Kopf, dann auf Papier und schliesslich am Set. In Zusammenarbeit mit dem Museum Folkwang in Essen ist eine Ausstellung entstanden, die Fellinis kreative Arbeit dokumentiert – von der Zeichnung zum Film. Man kennt gewisse Bilder auch ohne den entsprechenden Film, den kantigen Charakterkopf Casanovas beispielsweise, die drallige Anita (Ekberg) aus «La dolce vita», Gelsomina (Giuletta Masina) am Meer aus «La Strada» (1953/54) oder das Schiff «Die Rex» aus «Amarcord». Die Zeichnungen haben sich nicht selbständig gemacht, sondern sind künstlerische Vorboten, Gesichter, Visionen der Filme, die Federico Fellini dann realisiert hat. Dreizehn Filme werden in der Ausstellung aufgeblättert. Rund 500 Exponate dokumentieren die Werke des Film-Künstlers Fellini (1920–1993), schön chronologisch von «Lo sceicco bianco» (Die bittere Liebe, 1952) bis «E la nave va» (Fellini's Schiff der Träume, 1983) angeordnet.
Skizzen, Zeichnungen, Fotografien vom Set, Drehbuchauszüge, Filmplakate, Requisiten und Trailer verbinden sich zu einer Gesamtkunstwerk-Palette. Sie markieren fixieren und charakterisieren seine Filme. Ausgangpunkt sind meistens fast beiläufig hingeworfene Skizzen, Zeichnungen, Karikaturen. «Diese beiläufigen Ideen, diese Zufallsprodukte (…) sind dann die Wegweiser, nach denen sich meine Mitarbeiter richten: Bühnenbildner, Kostümbildner, Maskenbildner», unterstreicht Filmer Fellini. «Wenn ich einen Film vorbereite», schrieb Fellini 1971, «schreibe ich wenig. Ich ziehe es vor, die Personen, die Szenerien zu zeichnen.»
Das Sammelsurium an Entwürfen, Pointen und zeichnerische Fussnoten, diese An- und Einsichten machen Lust auf den ganzen Film (und nicht nur auf Trailer). Dafür fühlt sich die Kunsthaus-Kuratorin Cathérine Hug freilich auch nicht verantwortlich und verwies auf Kinos. Doch die Ausbeute ist mager. Es gab eine Aufführung des Dokumentarfilms «Auf den Spuren von Fellini» (2013) von Gérald Morin im Kunsthaus. DVD etc. sind eine Sache, Filme auf grosser Leinwand eine andere. Zu sehen sind nur «Roma» (1972) als Filmmatinee im Kino Piccadilly, Zürich, am 24. Juli (12 Uhr) und «La notti di Cabiria» (1957) im Openair-Kino Xenix, Zürich, am 10. August (21.15 Uhr). Da hätte mehr drin gelegen für Lichtspielstätten.
Die Materialien zu den Fellini-Filmen werden ergänzt durch Karikaturen (Fellini begann als Karikaturist), Briefdokumente, Telefonzeichnungen und Traumtagebücher. Cineasten werden begeistert sein und andere neugierig werden auf Werke wie «La città delle Donne» (1980), ein Film, der lange vor feministischem Aktivismus den Mann an den Frauenpranger stellt (der aber überraschend freigesprochen wird). Oder auf die nostalgische Hommage an Heimat: «Amarcord» (1973), der verrückte Film, der ein skurriles Sittenbild der Gesellschaft in den Dreissigerjahre vorführt (und mit einem Oscar belohnt wurde).
Seit den Fünfzigerjahren pflegten Daniel (1930–2011) und Anna Keel (1940–2010) eine enge und persönliche Verbindung zu Federico Fellini. Dazumal wurden bereits Fellini-Zeichnungen in der Keel-Galerie am Kunsthaus ausgestellt. Der Diogenes hütet und publiziert das literarische Erbe des Filmmeisters. Hier finden sich Notizen und Aufsätze, eine Biografie und andere illustre Bücher. Es lohnt sich, Fellini zu sehen und zu lesen.
Federico Fellini – Von der Zeichnung zum Film. Kunsthaus Zürich bis 4. September 2022
Eine persönliche Bücherauswahl
Cinecittà – Meine Filme und ich Federico Fellini, Inter Book 1988
Fellini. Eine Biographie Tullio Kezich, Diogenes Verlag 1989
Fellini's Zeichnungen. Einhundertachtzig Entwürfe für Figuren, Dekorationen, Kostüme, Telefonzeichnungen und Graffiti herausgegeben von Christian Strich mit einem Vorwort von Roland Topor, Diogenes 1976.
Federico Fellini. Von der Zeichnung zum Film Edition Folkwang, Kunsthaus Zürich, Diogenes Verlag 2022. Mit einer ergänzenden Broschüre, zusammen als Ausstellungspaket 42 Franken.
Aufsätze und Notizen Federico Fellini, Diogenes Taschenbuch 1974/1981
Denken mit Federico Fellini. Aus Gesprächen Federico Fellinis mit Journalisten Diogenes Taschenbuch 1984
Veröffentlicht Juli 2022
Ein Grusical vor dem Konstanzer Münster
Nosferatu – eine Schauermär für lebendes Ensemble und Blaskapelle. (Bild: Ilja Mess)
KULTURTIPP Die Kulisse ist einmalig, die Theaterprojekte im Konstanzer Sommer sind es ebenfalls. Diesmal haben sich die Theatermacher Mélanie Huber (Regie), Stephan Teuwissen (Buch), Lena Hiebel (Bühne, Kostüme) und Sebastian Androne-Nakanishi (Musik) eines legendären Stoffs angenommen. Sie inszenierten die Schauergeschichte «Dracula» des Iren Bram Stoker (1897). 100 Jahre nach der klassischen Stummfilmadaption «Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens» von Friedrich Wilhelm Murnau taucht der untote Graf Orlok als Gespenst am Konstanzer Münster auf: «Nosferatu» (bis 23. Juli).
Eine Warnung vorweg: Vergesst den buckeligen Untoten (Nomen est omen: Darsteller war Max Schreck) mit den Krallen in der «Symphonie des Grauens» aus dem Jahr 1922. Vergesst Klaus Kinski als Graf Dracula in Werner Herzogs blutigem Horrorklassiker «Nosferatu - Phantom der Nacht» aus dem Jahr 1979 – mit Bruno Ganz und Isabelle Adjani. Der «Nosferatu» von Konstanz hat mit dem Vampirklassiker nur den Namen gemein. Aber kriegt man als Zuschauer den filmischen Kult-Blutsauger aus dem Kopf …?
Mächtig überragt die Seitenfassade des Konstanzer Münster den Schauplatz. Eine Blaskapelle hat sich in einem Seitenportal eingenistet und bläst zur Schauermär – mal urig provinziell, mal jazzig-swingend wie aus den Wilden Zwanzigern. Richtig, die Geschichte spielt in Konstanz Anno 1922. Professor Van Hasselt (Ingo Biermann – wunderbar holländisch), eine Anlehnung an den holländischen Arzt, Forscher und Anwalt Van Helsing, doziert über Vampirismus und warnt den jungen Bert Hutter (Julian Mantaj) vor der Übernahme eines Schlosses in Transsilvanien, das er im Auftrag des Maklers Nogg (Patrick O. Beck) bewerkstelligen soll. Berts Ehrgeiz ist grösser. Er verabschiedet sich von seiner Braut Mathilda (Sarah Siri Lee König), beschenkt mit einem Medaillon, und reist zum Kaufobjekt, das einem gewissen Grafen Orlok (Luise Harder) gehört.
Alles klar! Von Anfang schleicht eine gespenstige Gestalt in schwarzer Kutte im Hintergrund umher: der bleiche Graf. Er tafelt mit dem ahnungslosen Jüngling Hutter, hat aber Appetit auf andere Nahrung. Er ist scharf auf Blut, aber das spielt in dieser Gruselgroteske nur eine Nebenrolle. Diese Gestalt hier mit wirrem Haar und Greisengesicht ist ein Schemen, ein Phantom, das dem geselligen Treiben nur erstaunt zusieht. Allein, er ist scharf auf den schönen Hals Mathildas. Ist sie zu retten?
Das bunte Völkchen, die Crew auf dem Totenschiff des Grafen sind Opfer oder Beobachter. Teilweise kommentieren sie das Geschehen, teilweise sind sie Betroffene. Die Perspektiven wechseln, so auch der Inszenierungsstil – mal Slapstick-Einlagen, mal intimes Spiel, Burleske oder Klamauk. Das Ensemble, das auch Rollen wahrnimmt so beispielsweise Odo Jergitsch als Wirt und Kapitän, leistet vollen Einsatz, auch bei Gesangsintermezzi. Das Bühnenbild spartanisch, die Musik, exklusiv vom Rumänen Sebastian Androne-Nakanishi komponiert, dramatisch bis motivierend, die Choreografie (Tanja Jäckel und Marvin Paulo- Muhongo) wild bis diszipliniert – die Inszenierung, geleitet von der Schweizerin Mélanie Huber, bietet viel und doch mögen sich die verschiedenen Ebenen nicht recht zum Ganzen fügen. Die Mär «in vierzehn, teilweise schrecklichen Bilder» wird Vampirfeunde und Draculakenner enttäuschen.
Der Konstanzer «Nosferatu» entpuppt sich als Grusical ohne Zähne –trotz witzige Lokalanspielungen und wilden Tänzen. Man staunt (oder ärgert sich) nur über einen harmlosen Grafen Orlok, der sich als blasser Abklatsch entpuppt. Mackie Messer und der Haifisch haben mehr Zähne …
«Nosferatu» auf dem Münsterplatz
Konstanz, Open Air bis 23. Juli (fast täglich) um 19.30 Uhr.
Tickettelefon 0049 – 7531 900 2150
theaterkonstanz.de
Veröffentlicht Juni 2022
«Ich verdanke es von Anfang an den Blumen, dass ich Maler geworden bin»
Eintauchen in eine 360-Grad-Bilderwelt: Monets Bilder tanzen in der Lichthalle Maag, Zürich (Bilde: rbr)
MONET'S IMMERSIVE GARDEN Vor zwei Jahren wurde der Holländer Vincent Van Gogh in der Maag Eventhalle Zürich spektakulär präsentiert: «Van Gogh Alive». Dann folgte die Mexikanerin Frida Kahlo («Immersive Experience» von September 2021 bis Ende Februar 2022) – sehr erfolgreich mit über 60 000 Besuchern. Die Lichthalle in Zürich entwickelt sich zum illustren, populären Museum.
Mittendrin und dabei: Nach Van Gogh und Frida Kahlo wird der französische Maler Claude Monet in der Lichthalle Maag Zürich inszeniert. Besucher können in «Monet's Immersive Garden» eintauchen (bis 17. Juli 2022). «Pixel ersetzen Pinselstriche, und die Konzentration auf vergrösserte Details sowie raffiniert eingesetzte Animationen und Soundeffekte offenbaren auch eine neue Dimension im Werk einer Künstlerin oder eines Künstlers», so beschreiben die Veranstalter ihre installierte «immersive Kunst». Und so können die Besucher regelrecht in eine fantastische Welt eintauchen und sich einlullen und faszinieren lassen. Die Bilder führen ein Eigenleben, mit jedem Schritt verändert sich die Perspektive. Die berühmten Garten- und Seebilder Claude Monets lösen sich auf und fügen sich wieder. Die Seerosen beginnen zu tanzen bei den Klängen von Ravels «Bolero». Farben zerfliesssen und verdichten sich. Die spektakuläre, reizvolle Licht- und Tonschau macht Gemälde, aber auch Landschaften lebendig. Das Ergebnis modernster Multimedia-Technik (360 Grad-Projektionen): Seerosen überfluten den Hallenraum. Es entsteht «die Illusion eines endlosen Ganzen».
Ganz im Sinne Monets: «Man muss meine Kunst nicht verstehen, sondern lieben.» Die gesprochenen Texte sind sorgfältig gewählt und ganz auf das Schaugeschehen abgestimmt. Auch die Informationen über Leben und Werk des Künstlers Claude Monet (1840–1926) lassen kaum zu wünschen übrig. Die zentralen Themen sind Licht und Schatten, Wind und Wasser sowie natürlich seine Garten- und Blumenimpressionen. Die fast schon süchtige Suche nach Licht wie auch seine Liebe zum Gärtnern manifestiert sich in seinen Gemälden. Monet liess sich von japanischer Gartenphilosophie inspirieren, legte selbst Wassergarten mit Brücke an.
1874 gründeten Künstler eine Gesellschaft, der auch Monet angehörte, um die materielle Basis nach der Wirtschaftskrise 1873 zu verbessern. Im April organisierte man eine Ausstellung. Monets Werk «Impression soleil levant» – Impression aufgehende Sonne) trug wesentlich dazu bei, dass der Kritiker Jules-Antoine Castagnary schnödete «Impressionisten seien Künstler, die nicht eine Landschaft wiedergeben, sondern die von der Landschaft ausgelöste Empfindung. Der Begriff Impressionisten war geboren.
Es ist dem visuellen Spektakel «Monet's Immersive Garden» zugute zu halten. dass auch weniger bekannte Werke Monets, beispielsweise Stadtansichten, Gesellschaftsbilder und andere Stimmungsbilder von Eisenbahnen, Brücken oder Porträts zur Geltung kommen. Informationen über wichtige Lebensabschnitte und Begebenheiten werden anschaulich und überschaubar dargestellt. Monets Garten-Impressionen samt illustren Beigaben regen die Sinne an und könnten erst recht zum Besuch der Originale animieren, beispielsweise Monets «Le bassin aux Nymphéas» (1917–1920), «La Cathédrale de Rouen» (1894) oder «Le pont japonais» (1918) in der Fondation Beyeler, Basel-Riehen.
Lichthalle Maag, Zürich: «Monet's Immersive Garden»
Vorläufig bis 17. Juli 2022
Dienstag bis Sonntag: 10 Uhr bis 18 Uhr
Freitag und Samstag: bis 20 Uhr,
Montag: geschlossen
Eintritt: Erwachsene 28 Franken (Di-Fr), 30 Franken (Sa/So).
Details: monets-immersive-garden.ch
Telefon: 0900 444 262
Zurück
Veröffentlicht Mai 2022
Videoex-Festival in Zürich
Fokus Arab Wave und Anka Schmid
Fast im Verborgenen blüht ein Pflänzchen, das nunmehr auf über 20 Jahre zurückblicken kann: Videoex, das internationale Experimentalfilm & Videofestival, aktuell vom 21. bis 29. Mai 2022 in Zürich, Cinema Z3 (Kanonengasse 20).FESTIVAL VIDEOEX ZÜRICH Es ist das einzige Festival in der Schweiz, so die Veranstalter, das sich explizit dem experimentellen und Film- und Videoschaffen widmet, verbunden mit einem Internationalen Wettbewerb. Einen Schwerpunkt bildet heuer das Gastprogramm Arab Wave. Videoex zeigt Filme aus dem Mittelmeerraum, die sich durch grosse Diversität auszeichnen, beispielsweise «La Zerda et les chants de l'oubli» (1982), ein Meisterwerk des feministischen und antikolonialistischen Filmschaffens von Assia Djebar (21. und 29. Mai). In dieser Reihe werden weitere Arbeiten aus Tunesien, Ägypten und dem Libanon zu sehen sein. Das Artist Special ist Lawrence Abu Hamden gewidmet, der sich mit der «Politik des Hörens» befasst (21. und 28. Mai).
Der Schweizer Fokus ist auf Anka Schmid gerichtet, deren jüngster amüsant-schelmischer Film «Wie die Kunst auf den Hund und die Katze kam» erst kürzlich am Fernsehen gezeigt wurde. Die Filmerin kreiert seit 40 Jahren (!) – mal verschmitzt («Magic Matterhorn», 1995), mal tierisch feministisch («Wild Women – Gentle Beasts», 2015) Filme. Mal geht es mit dem «Bauch durch die Wand» (2011) oder auch «Haarig» (2017) zu. Jüngst weckte sie Ohr und Auge mit dem filmischen Lobgesang «Loba Loba» 2021). Die Zürcherin ist eine «Grenzgängerin zwischen Film und Kunst», kreiert Videos oder schafft Kunstinstallationen. Sie nähert sich Wirklichkeiten und Befindlichkeiten, spürt magischen Zwischentönen und -welten nach. Sie ist dem Leben, heisst Begebenheiten, Eigenwilligkeiten und Menschlichem, auf der Spur – mit viel Phantasie und Verschmitztheit. Dieser CH-Fokus ist für den 22. und 24. Mai programmiert (ab 19.30 Uhr).
Detailliertes Programm und Tickets im Festivalzentrum (Kunstraum Walcheturm) oder online: https://videoex.ch/videoex/info
Tagespass 30/20 Franken, Einzeleintritt 16/12 Franken (Studierende AHV, IV)
Veröffentlicht Mai 2022
Ludwig lebt, und Udo ist präsent. Ein hör-und sehenswertes Museum in der Provinzstadt Gronau nahe der holländischen Grenze. (Bilder: rbr)
Locker vom Hocker mit
Rocker Udo
MUSEUM ROCK'N'POPMUSEUM, GRONAU Rock'n'Pop ist fester Bestandteil unserer Kultur geworden. Sie wurde durch Corona ausgebremst, zumindest was Livekonzerte angeht. Doch nun werden Hallen und Stadien wieder bevölkert. Zu einer festen Grösse im deutschsprachigen Rockuniversum gehört der Mann mit der schnoddrigen Schnute, Hut und Sonnenbrille. Udo Lindenberg. Er erlebt seinen x-ten Frühling mit der neusten Produktion und ist «Mittendrin». Mittendrin in der Rock- und Popmusik ist man auch im Museum in Gronau, in Westfalen nahe der holländischen Grenze.
Er ist so bekannt wie Helmut Kohl, Angela Merkel oder Herbert Grönemeyer. Udo Lindenberg ist ein Urgestein der deutschen Rockgeschichte und noch immer «Mittendrin», so der Titel seines neusten Hits:
«Das war 'n heisser Ritt, ich richte mein' Sombrero
Ich wisch' den Staub von mei'm Jacket, grüss' meine Compañeros
Tequila euch zu Ehren, keine Zeit zum Älterwerden
Wir bleiben einfach nicht stehen
Alles hört auf kein Kommando, scheiß' auf 'ne harte Landung
Es wird schon irgendwie gehen
Selbst in den heissesten Flammen
Das Fünkchen Hoffnung noch suchen
Denn selbst diе dunkelste Stunde hat nur sеchzig Minuten
Ey, willkommen mittendrin, schönen Gruß hier aus dem Hurricane…»
Ganz nah bei Udo und der Rockgeschichte, und nicht nur der deutschen, ist man im Rock'n'Popmuseum (seit 2004). In der ehemaligen Turbinenhalle eines Textilunternehmens in der westfälischen Grenzstadt Gronau wurde die Kulturgeschichte der Populärmusik inszeniert – am Udo-Lindenberg-Platz. «Gronau an der Donau», näselt der Rockstar zur Begrüssung im Museum. Ein Udo-Scherz natürlich. Udo wurde zwar 1946 in Gronau geboren, doch die Kleinstadt liegt an der holländischen Grenze, in Nachbarschaft zu Enschede. Dem Rockmusiker, der früher mal Pankow und DDR-Honecker ins Visier nahm und mit seinem Panikorchester für Musikrandale sorgte, wurde gar ein Bronzedenkmal errichtet. So richtig in Schwung kommen Besucher jedoch im Labyrinth des Rockpanoramas.
Der Gang durch die Geschichte beginnt mit Frank Sinatra, Folk (Woody Guthrie), Country (Johnny Cash, Kris Kristofferson etc.), Gospel und Blues führt zu Rock'n'Roll, Punk, Heavy-Metal, Disco und Gegenwart. Dabei werden die Beatles und Stones, Jimi Hendrix, Freddie Mercury (Queen) oder David Bowie ebenso gewürdigt wie die Scorpions oder Helen Fischer. Ausgerüstet mit Kopfhörern wandelt man von Vitrine zu Plakaten, Instrumenten oder Tonstudios-Ausrüstungen, stets von entsprechender Musik und Songs begleitet.
Das Museum, das dank Udo Lindenberg realisiert wurde, ist 2018 einer tiefgreifenden Umorientierung und Inszenierung unterzogen worden. Eine fabelhafte Fundgrube für alle Pop-und Rockmusikfans. Ergänzt wird die Dauerausstellung mit Sonderanlässen und -ausstellungen. So bis 3. Oktober mit der Sonderausstellung «Ludwig lebt! Beethoven im Pop». Ab 20. November gilt das Interesse «Eddie van Halen! The Last Guitar God».
Rock'n'Popmuseum , Gronau (Deutschland).
Eintritt: 9,50 Euro.
Zurzeit sind nur 30 Besucher im Museum erlaubt.
Am besten Zeitfensterticket buchen
rock-popmuseum.de
Veröffentlicht: September 2021
Literaturverfilmungen sind so eine Sache. Meistens geht's schief. Oft werden Romane, Geschichten, Erzählungen nur bebildert, nacherzählt. Immerhin gelangen einige sehenswerte Filmwerke wie «Homo Faber» von Volker Schlöndorff (1991), werkgetreu nach Max Frisch, oder auch Richard Dindos Filmgedicht «Homo faber (drei Frauen)» (2014). Rainer Werner Fassbinders TV-Reihe «Berlin Alexanderplatz» (1980 in 14 Teilen) oder die jüngste Verfilmung (2020) von Burhan Qurbani, die im modernen Berlin angesiedelt ist, gehören dazu. Und nun Dominik Grafs «Fabian oder Der Gang vor die Hunde». Da lohnt es sich, das Buch wieder mal zur Hand zu nehmen.
Mann mit moralischen Ansprüchen
BUCH FABIAN – DIE GESCHICHTE EINES MORALISTEN Erschienen ist Erich Kästners Grossstadtroman 1931, allerdings unter nationalsozialistischer Beeinträchtigung und Streichungen seitens der Deutschen Verlagsanstalt. Der Untertitel «Der Gang vor die Hunde» und ein Kapitel wurden gestrichen, einige erotische Passagen entschärft. Im Zuge der Nazi-Buchverbrennung 1933 wurden auch Kästners Bücher als «entartet» abgestempelt und verboten. Der Zürcher Atrium Verlag nahm sich «Fabian» an, publizierte aber erst 2013 die ungekürzte Originalfassung des Romans (2017 als Taschenbuch aufgelegt).
«Der ursprüngliche Titel, den, samt einigen krassen Kapiteln, der Erstverleger nicht zuliess, lautete 'Der Gang vor die Hunde'». Damit sollte, schon auf dem Buchumschlag. deutlich werden. dass der Roman ein bestimmtes Ziel verfolgte: Er wollte warnen», schrieb Kästner in einem späteren Vorwort. «Er wollte vor dem Abgrund warnen, dem sich Deutschland und damit Europa näherten!»
Ein Mann mit moralischen Ansprüchen taumelt Ende der Zwanzigerjahre durch ein brodelndes Berlin inmitten einer weltweiten Wirtschaftskrise und grassierendem Faschismus. «Das vorliegende Buch», so Kästner, «das grossstädtische Zustände von damals schildert, ist kein Poesie-und Fotografiealbum, sondern eine Satire. Es beschreibt nicht, was war, sondern es übertreibt. Der Moralist pflegt seiner Epoche keinen Spiegel, sondern einen Zerrspiegel vorzuhalten. Die Karikatur, ein legitimes Kunstmittel, ist das Äusserste, was er vermag».
Der besagte Moralist, also der 32jährige Germanist Dr. Jakob Fabian, arbeitsloser Werbetexter, stromert durch Berlin, und trifft Cornelia, Juristin, die aber als Schauspielerin gross herauskommen möchte. Sie verlieben sich. Sie weiss um den Moloch Grossstadt und charakterisiert ihn treffend: «Hinsichtlich der Bewohner gleicht sie (Berlin) längst einem Irrenhaus. Im Osten residiert das Verbrechen, im Zentrum die Gaunerei, im Norden das Elend, im Westen die Unzucht, und in allen Himmelsrichtungen wohnt der Untergang.»
Fabian ist unbeeindruckt, fühlt sich sicher. «Ich bin ein Melancholiker, mir kann nicht viel passieren. Zum Selbstmord neige ich nicht, denn ich verspüre nichts von diesem Tatendrang, der andere nötigt, so lange mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, bis der Kopf nachgibt. Ich sehe zu und warte. Ich warte auf den Sieg der Anständigkeit, dann könnte ich mich zur Verfügung stellen.» Doch gegen Liebe und Verlust ist der Müssiggänger und Beobachter nicht gefeit. Er schwimmt mit und geht doch unter.
Kästners Roman – und das ist wirklich erstaunlich – wirkt zeitnah und stimmig. Eine Vision, die von der Wirklichkeit eingeholt worden ist. Das hat auch den Filmer Dominik Graf wohl bewogen, «Fabian» ins Bild zu setzen (siehe Filmtipp): das Spiegelbild einer maroden Gesellschaft und tragische Liebesgeschichte zugleich.
Erich Kästner «Fabian – Die Geschichte eines Moralisten», Atrium Verlag Zürich 2017 (5. Auflage 2020), 12 Euro/14.90 Franken (Taschenbuch)
Kulinarische Kolumnen - lecker
BUCH DIE WELT AUF DEM TELLER Sie hat gehaltvolle Spielfilme wie die von den «Kirschblüten» (2008 und 2019) geschaffen und mit der Feder nicht zurückgehalten. Doris Dörrie (Foto: Mathias Bothor/Photoselection; Diogenes), in Hannover geboren, in München und der Welt (Japan!) heimisch geworden, hat Geschmack – so oder so. Hier wörtlich genommen. Die Autorin publiziert seit Jahren kulinarische Kolumnen im Magazin «Essen & Trinken» (Münster). Nun präsentiert ihr neustes Buch ebendiese «Inspirationen aus der Küche», die von August 2016 bis Juni 2020 im erwähnten Magazin erschienen sind.
Es sind kleine Reiseerzählungen von der norddeutschen Heimat bis Neapel, Vietnam, Japan oder den USA. Diese Appetitanreger (jeweils über zweieinhalb bis drei Buchseiten) liefern nebenbei kleine Kulturhappen. Da wäre beispielsweise eine Teezeremonie in Japan, welche die Regisseur bei den Dreharbeiten zu «Erleuchtung garantiert» durchmachte. Sie, die Teeliebhaberin, erlebte ihr blaues Wunder in einem Kloster – eine Tortur. «Die Teezeremonie», erzählt die Autorin, «die in Wirklichkeit keine Zeremonie, sondern einen Lebensweg illustriert, dauert zwischen einer und sechs Stunden und soll die Teilnehmer die Enge von Raum und Zeit vergessen lassen und zu entspannter Heiterkeit führen. Oder heiterer Entspanntheit. Am besten zu beidem. Für mich undenkbar. Nie war ich weiter vom Ziel entfernt, innere Stille und Gelassenheit zu erreichen.» Am Ende war Dörrie entnervt und «so erschöpft von meinen Schmerzen, meiner Ungeduld und Wut, dass ich gar nichts mehr schmecken konnte.»
Erstaunlich, die kulinarische Chronistin, laktoseintolerant und glutensensitiv, outet sich als «Veganerin, Clean, No Carbs und Raw Eater» und macht mit ihren Genusserfahrungen und Tipps gleichwohl Appetit. Das geht von «Knust und Scherzl», sprich (Brotkrusten) über Pasta und Pizza (Neapel!) bis zu Kartoffelsalat (Marke Linda) in Bhutan und Deutschland, zu Onigir, den japanischen Reisbällchen, oder Blümchenkaffee. Manchmal schrammen die Histörchen auch knapp am Appetitverleider vorbei, etwa bei den Ausführungen über den Oktopus, Tintenfisch oder die Krake, über die lieben Kühe, ihrer Milch und den Kälbchen. Schwamm drüber trotz vernichtender Umweltzahlen. Ich bleibe Fleischliebhaber und Käsegeniesser. Dörries Appell an gute Tischmanieren ist nur zu unterstreichen. Das «grosse Fressen» wie Mampfen im Tram, Bus oder Gehen, das Fast-Food-Herunterschlingen und hemmungslose Verhalten zu Tisch ist ein Gräuel. Ein klein wenig Grazie und Respekt bei Tisch täte der heutigen Essensgesellschaft gut und erhöhte das Geschmacksvergnügen – miteinander!
Doris Dörrie «Die Welt auf dem Teller», Diogenes Verlag, Zürich 2020, 27 Franken
Vom Gammelhai, einem Fuchs namens Schwarzkopf und einer Mauser
BUCH KALMANN Der Isländer, der aus Graubünden kam: Joachim B. Schmidt hat sich 2007 mit seiner Familie nach Island aufgemacht und lebt in Reykjavik. Nach Kurzgeschichten und drei Romanen hat der Bündner einen Krimi der anderen Art geschrieben: Kalmann, dieses Original, das seinem Grossvater mehr als nur die exzellente Zubereitung des Gammelhais zu verdanken hat, erzählt.
Ausgangspunkt ist eine Blutlache. «Das Blut glänzte rot und dunkel im weissen Schnee. Die Schneeflocken legten sich unaufhörlich darauf und schmolzen in der Blutlache. Mir war ganz heiss vom Gehen, und ich schwitzte, aber weil ich jetzt plötzlich stillstand und einfach nur bewegungslos auf die Blutlache starrte, begann ich zu schlottern.»
Kalmann Óɓinsson, 34 Jahre alt, Haifischjäger, ist ein Sonderling von Kindesbeinen an. Ein Mann ist verschwunden, Róbert McKenzie, Fischer. Birna, Polizistin in Zivil, ist aus der Hauptstadt angereist, um in dem abgelegenen Nest Raufarhörfn nach dem vermissten Robert zu suchen. Kalmann, der von Birna ernannte Dorf-Sheriff mit Cowboyhut, Stern und Mauser, soll ihr dabei helfen…
Ein Kriminalfall oder ein Unfall oder nur ein Verschwinden aus unbekannten Gründen? Als Leser nimmt es wunder, was das ungleiche Paar in Islands eisiger Einöde da zu finden hofft. Mit Akribie und verschmitztem Verständnis beschreibt Joachim B. Schmidt eine ungewöhnliche Fahndung, die dann irgendwann beim Grossvater und Gammelhai endet. Den bis ins letzte Detail stimmigen Roman mag man gar nicht mehr aus der Hand legen. Ein Buch quasi aus dem Abseits, das trifft, wie die Mauser einen Eisbären. Man schmeckt das Meer, den Schnee, riecht den Eisbären und erfährt, dass ein vermeintlicher Dorftrottel auch ein Lebensretter sein kann.
Joachim B. Schmidt: «Kalmann», Diogenes Verlag 2020, 30.00 Franken
Artwork Wake-Up
KUNST UTE UND WERNER MAHLER Museen sind geschlossen wie auch Kunstausstellungen und Galerien. Aber es Alternativen – online. Die Galerie Springer Berlin lädt seit geraumer Corona-Zeit zu Fotoausstellungen ein – unter dem Titel «Artwork Wake-Up, nunmehr #103». Zurzeit sind Werke des Fotografenpaars Ute und Werner Mahler zu sehen, zumeist Schwarzweissbilder (mindestens bis Ende Februar 2021). Das Ehepaar (seit über 40 Jahren!) gehörte schon zu DDR-Zeiten zu den herausragenden Fotokünstlern. Ute, 1949 in Thüringen geboren) und Werner Mahler (1950 in Sachsen-Anhalt geboren) porträtieren Menschen, dokumentieren Alltag, halten Posen und Momente fest.
In der Galerie sind zumeist Schwarzweissbilder aus den letzten fünf Jahrzehnten zu sehen, etwa unter dem Titel «Auf dem Land. Am Fluss», «An den Strömen» (Elbe oder Rhein), «Stahlwerk Martin Hopp» (1975), «Zirkus» (1973/74), «Fashion» oder «Paris» (1979). Da scheint eine Primaballerina vor der Komischen Oper, Berlin (1980) zu tanzen, posieren Mona Lisen der Vorstädte in Florenz, Minsk oder Berlin. Da schuften Bergwerksleute (1975), «erstarren» Frauen in der Wüste auf Gran Canaria (1994) oder wird der Kreidefelsen auf Rügen von einem Regenbogen «geküsst». Impressionen, die Geschichten von Begegnungen erzählen. galeriespringer.de > Link virtueller Galerierundgang / virtual gallery tour
Bücher mit Fotografien von Ute und Werner Mahler: «Monalisen der Vorstädte», Verlag Meier und Müller, Berlin 2013. «Kleinstadt», Hartmann Projects, Stuttgart 2018. «Werkschau» in den Deichtorhallen in Hamburg, Haus der Photographie, 2014, Katalog (ExLibris 64 Franken).
Wer Lust hat, in den Beständen (bisherigen Ausstellungen) der Galerie Springer Berlin zu stöbern, stösst auch auf den Innerschweizer Kantonspolizisten und Fotografen Arnold Odermatt galeriespringer.de/artists.
Provokateur, Poet und Poltergeist
BUCH FRIEDRICH DÜRRENMATT Gut gibt es Geburtstage (und Todestage), dann können auch in newsarmen Zeiten Seiten gefüllt werden. Nun, «Das gemütliche Ungeheuer» (NZZ am Sonntag) hat es verdient. Der Berner Provokateur, Poet und Poltergeist, den die Nachwelt «als Schulbuchautor eingesargt» (Tages-Anzeiger) hat, ist der «grösste Schweizer Autor» (Franz Hohler). Friedrich Dürrenmatt, am 5. Januar 1920 geboren, am 14. Dezember 1990 gestorben, ist Analyst seiner Zeit, der Gesellschaft und des Landes, Fabulierer und Visionär. Man nehme nur einmal wieder seine Komödie «Der Meteor» von 1966 zur Hand. Das Unerwartete, das Unberechenbare fällt in den Alltag, in die Welt ein. «Ein weiterer Aspekt aus dieser Paulus-Lektüre (…) ist der gewalttätige Einbruch des Unbedingten ins Bedingte, die Unberechenbarkeit, die sich positiv zum Glück oder negativ zur Katastrophe auswirken kann», schreibt Ulrich Weber in seiner jüngsten Dürrenmatt-Biographie. Wer würde da nicht den Bogen vom Meteor zum grassierenden Virus Covid-19 schlagen!
Heute wie vor 50 oder mehr Jahren werden seine bekannten Bühnenstücke wie «Die Ehe des Herrn Mississippi» (1952), «Der Besuch der alten Dame» (1956), «Die Physiker» (1962), «Der Meteor» (1966), «Die Wiedertäufer» (1967) oder «Porträt eines Planeten» (1970) aufgeführt. Und noch immer sind seine Stoffe aktuell. «Dürrenmatt hätte wohl gelacht» schrieb Mario Andreotti im St. Galler Tagblatt über den Berner Dramatiker, seine Komödie «Der Meteor» und die Pandemie heute.
Über das Erzählgenie hat Ulrich Weber, Kurator des Dürrenmatt- Nachlasses im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern, eine voluminöse Biographie mit weit über 700 Seiten verfasst. Er spannt den weiten Lebensbogen von der «Kindheit im Emmental» bis zu den «letzten Auftritten und einem politischen Vermächtnis.» Wer gerne schmökert, wird alleweil fündig – sei es den Privatmenschen, Trinker und Geniesser Dürrenmatt betreffend, den Erfolgsdramatiker, Theatertitan, Dichter, Denker, Maler oder Kranken («Die Rebellion gegen den Körper»). Ein grossartiges Buch, das sich eines grossartigen Autors und zeitkritischen Denkers würdig erweist. Es bietet ein Füllhorn von Informationen, Einsichten, Interpretationen und Kommentierungen, mit einigen Bilderpassagen ausgeschmückt und einem dicken Anhang ergänzt (über 110 Seiten). Hier findet man nicht nur einen Stammbaum vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, sondern auch Chronik, Quellenangaben und Endnoten. So wird uns der Erzähler, Dramatiker, philosophischer Denker, «Satiriker von schonungsloser Schärfe, der die Mächtigen und Grossen mit seinem Spott überzog», «Abenteurer des Geistes», Erkenntnisskeptiker, «Weltenschöpfer, dessen Vorstellungskraft vor keinen räumlichen und zeitlichen Dimensionen haltmachte», «visionärem Zeichner und Maler» sehr nahe gebracht. Webers fulminante Biographie ergänzt und vertieft die frühere von Peter Rüedi «Dürrenmatt oder Die Ahnung vom Ganzen» (2011). Das jüngste Werk animiert geradezu dazu, das eine oder andere Dürrenmatt-Buch zur Hand zu nehmen.
Empfehlenswerte Lektüre
Ulrich Weber «Friedrich Dürrenmatt», Eine Biographie, Diogenes Verlag, Zürich 2020, 42 Franken
Peter Rüedi «Dürrenmatt oder Die Ahnung vom Ganzen», Diogenes Verlag 2011. Fr. 39.90
«Friedrich Dürrenmatt und andere Meistererzählungen», Diogenes Verlag 1992, 2011 (ExLibris Fr. 13.60)
«Dürrenmatt: Der Hund. Der Tunnel, Die Panne», Hörbuch gelesen von Hans Korte, Diogenes Verlag 2010, 30 Franken
«Dürrenmatt. Sein Leben in Bildern», Diogenes Verlag 2011, Fr. 68.00
Dauerausstellung «Friedrich Dürrenmatt – Schriftsteller und Maler», Centre Dürrenmatt in Neuchâtel/Neuenburg»
BUCH ALLES SCHON MAL DAGEWESEN Was wir 2020 erlebt haben und weiter ertragen und bekämpfen, den Virus Covid-19, wurde in vielen Geschichten und Filmen so oder so vorweggenommen und dargestellt. Aber wer glaubt schon Filmen mit Katastrophenszenarien? Es ist doch alles nur Kino. Denis Newiak aus Potsdam, studierter Medienwissenschaftler, ist diesem Phänomen auf den Grund gegangen und hat Erstaunliches zutage gefördert. Die grassierende Pandemie sei keineswegs überraschend, stellt er fest: «Wirklich überraschend war an der Corona-Krise genau genommen nur eine einzige Sache – nämlich, wie überrascht alle waren und wie Entscheidungsträger und Politiker mit der Situation überfordert wirkten. Dabei hätte man zum Beispiel wissen müssen, dass sich «ein neuartiger Krankheitserreger in einer zunehmend verflochtenen, mobilen und globalisierten Welt rasant ausbreiten und sich auf alle Sphären des sozialen Zusammenlebens auswirken kann.»
In seinem Buch beschreibt er anhand von rund zwei Dutzend Filmen und Serien, welche Pandemie-Szenarien auf Leinwand oder Screen bereits Wirklichkeit wurden, wie sie wirkten und was sie verursachten, beispielsweise Hoffnungslosigkeit und Angst, Demoralisierung und Einsamkeit. Hier sei nur das Beispiel von «unerhörten Propheten und unerhörten Profiteuren» genannt. Die Rede ist vom Film und von der Serie «12 Monkeys» mit Bruce Willis. Dem Mann aus der Zukunft glaubt man nicht (in der Gegenwart), der vor einer Virus-Epidemie warnt. Niemand will diese «Epidemie des Irrsinns» wahrhaben, hört auf seine unerfreuliche, kompromisslose Wahrheit. Der unerhörte Prophet gehört längst zum Standardrepertoire eines Apokalypse-Films.
Newiaks Buch der Pandemie-Filme, seine Schlüsse und Verbindung zur Gegenwart sind hochinteressant, spannend zu lesen, anschaulich und aufschlussreich. Kein Fantasy-Produkt, sondern eine fundierte Analyse, die eine Krise wie Corona zwar nicht bewältigen kann, aber ihre sozialen, politischen und ökonomischen Herausforderungen und Gegebenheiten veranschaulicht.
Denis Newiak «Alles schon mal dagewesen», Schüren 2020, CHF 18.30
BUCH 50 JAHRE SONNTAGSMORD Krimis gehören zum beliebtesten Genre in Film, Fernsehen und Literatur. Die erfolgreichste deutsche Fernsehreihe «Tatort», auch mit Schweizer und österreichischer Beteiligung, hat viel dazu beigetragen. Sie feierte im letzten Jahr ihr 50jähriges Dasein und ist einfach nicht tot zu kriegen. Das Büchlein von Siegfried Tesche erweist dem Jubilar die Ehre – mit Fakten, Beiträgen, Anekdoten und Illustrationen (Oli Hilbring) zum Schmunzeln. Hätten Sie gewusst, dass man in Schweden mit einem «Tatort»-Drehbuch Deutsch lernt, die ersten «Tatort»-Folgen rund 300 000 DM kosteten, aktuell aber 1,5 bis 1,7 Millionen Euro? Im teuersten «Tatort – Der grosse Schmerz» hatte Helene Fischer einen Gastauftritt, er verschlang 2,1 Millionen Euro.
Bei den Anekdoten tauchen Schweizer dreimal auf: Der erste «Tatort nach zehn Jahren Pause hatte Anfangsschwierigkeiten und erntete vernichtende Kritiken. Die Schweizer Kommissarin Liz Ritschard soll lesbisch sein. Fahnder Reto Flückiger (2011–2019) alias Stefan Gubser nahm nach den letzten Dreharbeiten ein blaues Jackett und seinen Dienstausweis mit, um vielleicht mal Polizist zu spielen und Raser abzukassieren.
Wer will, kann sich auch an einem «Tatort»-Quiz vergnügen oder an Skandalen und Aufregern ergötzen. Die Hälfte der Tatort-Sammlung nehmen Zahlen und Statistiken sowie Zitate ein. Eine Kostprobe: Die meisten Zuschauer lockte der «Tatort – Rot – Rot – Tot» mit Curd Jürgens und 26,57 Millionen Zuschauern (1978) an. Bei den Gagen hält Til Schweiger mit 300 000 Euro die Spitze, gefolgt von den Münsteranern Jan Josef Liefers und Axel Prahl mit 100 000 bis 120 000 Euro (Stand 2016). Die Schweizer Delia Mayer und Stefan Gubser sollen 30 000 Euro verdient haben. Zum Schluss ein Zitat von Götz George über Schimanski: «Dieser Schimanski hat auch ein Stück George drin. Ich kann mich bei dieser Kunstfigur viel besser ausleben, mal ausflippen, mal Witze machen und mich einen Dreck um Dienstvorschriften kümmern.» Es lebe der «Tatort»!
Siegfried Tesche «50 Jahre Sonntagsmord», Lappan Verlag 2020, CHF 16.90
Harsche Historienkrimis
BUCH 1793 UND 1794 Ein ungleiches Duo – wie so oft in Krimis. Hier agieren zwei gegensätzliche Männer Ende des 18. Jahrhunderts, der Krüppel Jean Michael Cardell und der Ermittler Cecil Winge. Kriegsveteran Cardell hält sich mühsam als Häscher und Stadtknecht über Wasser. Der Mann mit amputiertem Arm, genannt Mickel, sieht aus «wie so viele Männer auf Stockholms Strassen – Männer, die durch Elend und Krieg ihrer Jugend beraubt wurden und vorzeitig gealtert sind.» Er hat einen «muskulösen Rücken, Beine wie Baumstämme und die rechte Faust ist gross wie ein Schweinebug». Der Mann aus der Gosse wird von Sonderermittler Winge als Assistent, als Mann fürs Grobe engagiert. Sie haben es mit einem grausamen Fund zu tun. «Karl Johan (so nennen die beiden die Leiche) fehlen Arme und Beine. Alle viere sind so nah am Rumpf abgenommen worden, wie Messer und Säge eben Spielraum hatten. Und auch die Augen fehlen; die Augäpfel sind aus den Höhlen entfernt worden.» Schweden um 1793. Der autoritäre König Gustav III. hatte Krieg gegen Russland Krieg geführt (1788–90) und wurde 1792 Opfer eines Attentats. Sein Nachfolger war sein Gustav IV Adolf, Gegner der Französischen Revolution.
«1793» – ein drastischer Fall. Der zerstümmelte Tote ist eine harte Nuss, die es zu knacken gibt. Winge, der unter starken Hustenanfällen (Schwindsucht) leidet, denen selbst durch absonderliche Mittel und Methoden nicht beizukommen war, und sein Gehilfe stossen auf ein Monstrum. Schlussendlich führt Winge selbst den Täter durch eine Finte dem Galgenberg zu und ist selber dem Tode nah.
Im zweiten Roman «1794», ebenfalls ein Wälzer von über 550 Seiten, versucht Cardell einen adeligen Ehemann, der seine frisch angetraute Frau aufs Grausamste getötet haben soll, zu rehabilitieren. Ihm zur Seite agiert nun Emil Winge, der Bruder des verstorbenen Cecil Winge, dazumal Ermittler im Dienste der Stockholmer Polizeikammer. Emil ist ein heruntergekommener Trinker aus Uppsala, den Cardell «ernüchtert». Sie spüren eine Bestie auf – in einem verheerenden Schlusssakt.
Beide Romane gliedern sich in drei Teile, rückwärts in Herbst, Sommer und Frühling (1793) sowie Winter, Sommer und Frühling (1794). Je ein Teil ist in Ich-Form geschrieben. Einmal berichtet Opfer und Täter Kristofer Blix seiner Schwester (Sommer 193), dann schildert Erik Drei Rosen, der Bräutigam, der seine Braut Linnea Charlotta grausamst umgebracht haben soll und ins Tollhaus eingewiesen wurde, sein Leben (Winter 1794).
Der schwedische Autor Niklas Natt Och Dag (41) liebt es, sein Geschichten zu verschachteln und von hinten aufzuschlüsseln. Geradezu akribisch beschreibt er Zeit und Ort, aber auch die blutigen Ereignisse, Ermittlungen, Erkenntnisse. Er beschönigt nichts und schreckt auch nicht vor harschen detaillierten Beschreibungen zurück. Seine historischen Kriminalromane sind aussergewöhnlich, stimmig, schmutzig, verästelt. Schmöker, die man so leicht nicht aus der Hand gibt.
Niklas Natt Och Dag: «1793» und «1794», Piper Verlag 2019/2020, je CHF 19.90
Teenager-Nöte
FILM – STREAMING UNE COLONIE Der Titel ist etwas irreführend, meint es gut, trifft aber knapp daneben. Die Kanadierin Geneviève Dulude-De Celles beschreibt in ihrem Spielfilmerstling, wie junge Leute Sinn und Halt auf der Schwelle zum Erwachsenenwerden suchen. Es ist eben kompliziert, mit Hoffnungen und Enttäuschungen verbunden. Die zwölfjährigê Mylia (Emilie Bierre) versteht sich bestens mit ihrer kleinen Schwester Camille (Irlande Côte), betreut sie, umsorgt sie, herzt sie. Doch sie selber ist unsicher, sieht sich in der Schule aus Aussenseiterin und fühlt sich zum Aussenseiter Jimmy (Jacob Whiteduck-Lavoie) hingezogen, einem Abkömmling der Abenaki-Indianer. Er ermuntert die scheue Mylia, aus sich herauszugehen, mutiger aufzutreten, sich zu finden. Die Filmautorin steht ihrer Hauptfigur sehr nah – mehr soft als markant, mehr fraglich als konkret. Die Kolonialproblematik heute, das Aussenseitersein, die Fragilität von Freundschaft werden angesprochen, aber nicht vertieft. Die beiden jungen Darstellerinnen überzeugen gleichwohl auf der ganzen Linie. Streamingdienst: Outside the Box
Im Dunkeln
FILM – STREAMING LOS SONAMBULOS Ein Familientreffen (im Film) bedeutet meistens nichts Gutes. Augenscheinliche Harmonie bekommt Risse. Vertrauen, Verbundenheit, Familie werden infrage gestellt. Luisa (Erica Rivas) reist mit ihrem Mann Emilio (Luis Ziembrowski) und ihrer Teenager-Tochter Ana (Ornella D'Elia) zum elterlichen Landhaus, um dort mit anderen Familienangehörigen Neujahr zu feiern. Die ersten Bilder weisen bereits daraufhin, dass sich Umbrüche und Veränderungen anbahnen. Die Tochter bekommt ihre Periode, die erste oder zweite, und hat dies vor der Mutter verheimlicht. Verschiedene Interessen und Begehrlichkeiten der Familienmitglieder stossen aufeinander. Der charmante, jugendliche «Sonnenschein» Alejo wird zum Störfaktor. Er flirtet nicht nur mit Luisa, sondern vor allem mit Ana, der Schlafwandlerin (Somnambule), die nicht weiss, auf was sie und wie weit sich einlassen soll. Auch ihre Mutter Luisa spürt ein Verlangen, das sie je länger je weniger unterdrücken kann. Eine Zeit des Umbruchs, der Entscheidungen, der physischen wie psychischen Veränderungen. – Die Argentinierin Paula Hermández entwirft ein Familienbild mit Rissen, wo Probleme aus dem Dunkel ans Licht treten. Ein sensibles sommerliches Drama über unterschwellig glimmende Gefühle und Sehnsüchte. Streamingdienst: filmingo (Trigon Film).
König der Dunkelheit
BUCH: CLINT EASTWOOD Der alte Haudegen Clint Eastwood, just im Mai 90 Jahre alt geworden, ist als Filmemacher engagiert wie eh, auch wenn er mit dem «Fall Richard Jewell» nicht gerade ein Meisterwerk geliefert hat. Aber der Film fügt sich schier nahtlos in sein Werk ein. Eastwoods Helden sind keine Strahlemänner, keine glorreichen Heroen, schon gar keine Halunken, wie er sie einst selber verkörperte in den Italo-Western à la Sergio Leone «Per un pugno di Dollari» (1964) oder «Il Buono, il Brutto, il Cattivo/Zwei glorreiche Halunken», 1966).
Sowohl «American Sniper» (2014) über einen Navy-Scharfschütze, als auch «The Mule» (2018) über einen bald 90jährigen Drogenkurier sind gebrochene Helden. Gleichwohl haben es ihm Retter wie «Sully«» (2016), dem Piloten, der ein Passierflugzeug auf dem Hudson River landete, angetan. Eastwood ist längst eine Italo- und Hollywood-Legende, eine Ikone vor und hinter der Kamera. Kai Bliesener hat ihm ein packendes Buch gewidmet: «Clint Eastwood – Mann mit Eigenschaften». Ein Essay von Georg Sesslen, Interviews von Frank Brettschneider oder Tobias Hohmann («Eastwood ist ein zäher Hund») und vertiefende fulminante Beiträge über den «König der Dunkelheit» oder «schauspielernden Regisseur zeichnen ein lebendiges Porträt des letzten grossen Hollywood-Heroen. Und sie machen Lust, seine Filme wiederzusehen von «Dirty Harry» (1971) über «Outlaw Josey Wales» (1976) und «Honkytonk Man» (1982) bis «Bird» (1988), «Million Dollar» (2004) oder «Gran Torino» (Bilder, 2009).
Seit 65 Jahren (!) ist Eastwood im Filmgeschäft. Sein Gesicht, seine Mimik, sein Gang, seine Gesten haben sich eingeprägt. Eine «spannende ambivalente Persönlichkeit, deren Eigenschaften sich zu ergründen lohnen«», schreibt Bliesener in seinem Vorwort «Beschreibung eines Denkmals». Er ist eine Ikone, ein «einsamer Wolf», ein politisch liberaler Rebell, der sich auch mal vor den Karren der Republikaner spannen liess. Aber: «Eastwood selbst ist alles andere als ein Rechtspopulist», meint Journalist Frank Brettschneider im Interview.
Kai Bliesener «Clint Eastwood – Mann mit Eigenschaften», Schüren Verlag Marburg 2020, CHF 29.50
Welche Wahrheit?
FILM IM KINO (WIEDERAUFNAHME): LA VERITE Die alternde Diva Fabienne (Catherine Deneuve) hat ihre Memoiren unter dem Titel «La Vérité» veröffentlicht und nimmt es doch mit eben dieser Wahrheit nicht so genau. Sie lässt aus, beschönigt, lügt. Ihre Tochter Lumir (Juliette Binoche) ist mit ihrem Mann Hank (Ethan Hawke) und Töchterchen Charlotte (Clémentine Grenier) von New York nach Paris gereist, um das Buch zu feiern. Sie muss gleichwohl feststellen, dass ihre Mutter weiter den schönen Schein wahrt und sich mit einem Netz aus Halbwahrheiten und Beschönigungen umgeben hat. Alte Verhältnisse werden gegenwärtig. Wie ein Phantom ist Sarah gegenwärtig, Fabiennes Schwester, Schauspielerin, Konkurrentin. Szene um Szene, auch bei Fabiennes aktuellen Dreharbeiten, werden Versäumnisse, Verletzungen, Verdrängungen deutlich. Fabienne hatte einst Sarah ausgestochen, Lumir ist vor ihrer Mutter geflohen und nun versucht die Diva, ihrer neusten Rolle zu entfliehen. – Hirokazu Kore-eda, Buch und Regie, hat seinen Film auf den grossen französischen Star Catherine Deneuve zugeschnitten, die all ihre Klasse, ihre Ausstrahlung und Ehrlichkeit zu sich selbst ausspielt. Der Japaner hat mit «La Vérité» seinen ersten Film im Ausland realisiert. Er schildert einen Mutter-Tochter-Konflikt als intimes Familiendrama über Angst und Flucht vor Wahrheiten, aber auch über Dreharbeiten und Befindlichkeiten der Akteure. Siehe auch Filmkritik.Kleine Fluchten
FILM IM KINO (WIEDERAUFNAHME): MARE Frau, Familie und Routine: Das kann's doch nicht gewesen sein. Das sagt sich Mare (Marija Škaričić). Sie hat einen «abgelöschten» Ehemann, drei Kinder im Teenageralter, sie liebt ihre Familie, lebt am Rande des Flughafens von Dubrovnik und hat Sehnsüchte. Der Alltag, die Ehe ist zur Routine geworden. Ihr Mann Duro (Goran Navojec) ist eben nur noch Teil einer Zweckgemeinschaft geworden, die Leidenschaft erloschen. Das Meer in der Nähe, der Flughafen vor der Haustür die wecken Mares Sehnsüchte. Sie möchte die Eintönigkeit des Alltags durchbrechen und alte Freiräume erobern. Als sie eines Tages Kontakt zum jungen polnischen Nachbarn Piotr (Mateusz Kościukiewicz) knüpft, gibt sie ihrem Begehren nach. Die Luzernerin Andrea Štaka, 2006 Schweizer Gewinnerin des Goldenen Leoparden von Locarno mit «Das Fräulein», knüpft mit «Mare» an alte Themen an – wie Frausein, Freiheit, Heimat, Orientierung. Siehe auch Filmkritik.Tipps vom 24. Mai 2020
Nach Absperrungen und Abschottungen beginnt nun die Phase der Lockerungen, des leisen Öffnens. In Zeiten der Mutmassungen, des Massregelns, aber auch des Mutmachens sind Ratschläge gefragt. Genau das wollen wir: Anregen und Empfehlen.
Man könnte Einblick nehmen an Michael Steiners Momentaufnahmen «Switzerlanders» (myfilm.ch) oder das 6. Iranische Film Festival Zürich (28. Mai bis 3. Juni) online verfolgen (iranianfilmfestival.ch). Wir haben uns speziell umgesehen und stellen vor: Breiner's Five – bemerkenswerte Filme fürs Heimkino, Tipps für die Glotze:
Verloren
FILM – STREAMING: THE CHARMER Ein Mann um die 30, gutaussehend, aber einsam und fremd in Dänemark. Esmail (Aradalan Esmaili) stammt aus dem Iran. Er lebt seit ein paar Jahren in Dänemark, verdingt sich als Möbelpacker und geht abends auf Pirsch. Er sucht Frauen, eine legitimierte Verbindung, um so eine permanente Aufenthaltsbewilligung zu bekommen. Meistens verlieren sich diese One-Night-Stands, bis er Sara (Soho Rezanejad) kennenlernt. Eine intelligente, attraktive junge Frau aus gutem persischen Haus. Man/frau verliebt sich. Die Mutter Leila, eine geschätzte Sängerin, findet Gefallen am Verlobten ihrer Tochter Sara. Man schmiedet Heiratspläne, doch Esmail, der Charmeur, trägt eine schwere Last mit sich. Im Iran wartet eine Familie … Milad Alami (Regisseur und Autor), 1982 in Teheran geboren, beschreibt in seinem dänischen Liebes- und Sozialdrama «Charmøren» (The Charmer, 2017) das unauflösliche Problem der Einsamkeit in der Fremde, der Herkunft, der Heimat und Verantwortung. Der Verführer Esmail wechselt die Identität, verführt quasi in der Not, verliebt sich und verliert sich. Er sucht seinen Platz und wird auf sich selbst und seine Herkunft zurückgeworfen. Ein starker Film nicht nur über Emigration, sondern auch über existentielle Einsamkeit und verlorene Liebe. Streaming: filmingoAuge um Auge
FILM – STREAMING: EUTHANIZER Er bastelt und flickt Motorräder. Veijo (Matti Onnismaa) ist ein Sonderling, zuständig für «Reparaturen und Endlösungen». Der «Einsiedler» tötet auf Wunsch auch Tiere – human sozusagen. Kleine Lebewesen vergast er im Auto, grössere erschiesst er und begräbt sie. Doch er tritt nur in Aktion, wenn er ein Tier von seinem Leiden erlösen kann. Ein Hund, der dem Besitzer Petri, einem punkigen Fascho, lästig geworden ist, soll er gegen Bares töten. Doch Veijo entscheidet, den Todeskandidaten, den er Piki nennt, am Leben zu lassen. Der komische Kauz hat seine Karma-Prinzipien, zum Beispiel ist er überzeugt, dass alle Handlungen Konsequenzen haben, dass Schmerz und Schuld ausgeglichen, dass alle Vergehen – auch an Tieren – gebüsst werden müssen, eben Auge um Auge, Zahn um Zahn. Lotta (Alina Tomnikov), die ihn auch um einen Gefallen bittet, freundet sich mit dem Tierfreund und Sonderling zaghaft an. Doch niemand kann in Frieden leben, wenn es den bösen Zeitgenossen nicht gefällt. Als Petri, der gewalttätige Familienvater mit neofaschistischen Hirngespinsten, entdeckt, dass sein Hund nicht getötet wurde, mobilisiert er seine rassistischen Punkkumpels («die finnischen Soldaten»), um dem Tierfreund und dem Hund eine Lektion zu erteilen. – Der Finne Teemu Nikki ist nicht zimperlich und autark – als Autor, Regisseur und Produzent. Sein rigoroser Thriller «Armomurhaaja» (Euthanizer) entstand bereits 2017. Einerseits ist dieser rüde spröde Film aus Finnland ein Liebesfilm, andererseits eine Abrechnung, ein Drama um Schuld und Sühne, Gewalt und Gegengewalt. Wohl allzu brutal und gnadenlos für sanfte Gemüter und Seelen. Streaming: Outside the Box (Partnerkinos in den Städten von Aarau bis Zürich)Spinnig, sinnig, sur- und real
FILM – STREAMING: COLLECTION LOCKDOWN BY SWISS FILMMAKERS Eine Idee, die auf fruchtbaren Boden fiel: Dem Aufruf zu einer Collection Lockdown, initiiert vom Welschen Produzenten Frédéric Gonseth und Anne-Laure Daboczi, vom Zürcher Michael Steiner und der Tessinerin Michela Pini, folgten 80 Filmemacher/-innen. Sie reichten Kurzfilmprojekte ein. 33 Filme wurden realisiert, getragen von der SRG, dem Bundesamt für Kultur und Cinéforum. Die Spannbreite der filmischen Arbeiten (bis zu 11 Minuten) reicht von Alltagsimpressionen eines Dealers (Michael Steiners «Time of My Life») oder einer Familie (Thomas Haemmerlis «Heimschule für Klugscheisser» (Bild) sowie Luise Hüslers «2 Kinder, 7 Kameras, 1000 Verbote») bis zu absurden Episoden in «Dass niemand weiss» (Bild) von Martin Guggisberg und Ruth Schwegler oder in Anka Schmids «Coronal Surreal». Sinnig und sinnvoll reflektieren zwei Männer die Corona-Wirkungen, der eine als Bergführer, dem die Wanderer im Berner Oberland fehlen, und der andere, der den Wald und die Abgeschiedenheit liebt, dort Ruhe und Energie findet. Der besinnliche Kurzfilm «Echo» von Noël Dernesch und Sophie Toth unterstreicht, dass der Lockdown auch eine Chance ist, sich zu besinnen, bescheidener und ernsthafter zu sein. Regisseurin Andrea Štaka widmet sich (zwangsläufig) ihrer Familie, nachdem drei Tage nach dem Kinostart ihres Films «Mare» der Corona-Vorhang fiel: «My Mom, My Son and Me» und die Corona-Einschränkungen. Yoav Parish zeigt, was passiert, wenn man sich in solchen Pandemie-Zeiten zu nah kommt: «Chli znöch – Out of Touch». Lily und Stéphane Goël begleiten ein älteres Paar: «Les pesiférés». Ein impressionistischer Film mit krassem Titel («die Aussätzigen, die Pest-Infizierten»), der eine Lanze für vorverurteilte ältere Menschen bricht. Die Bilder vom Seniorenpaar werden ergänzt mit Impressionen von Vögeln, einer Katze, Blumen, stillen Szenen. Eine bunter Strauss von Filmen – persönlich, besinnlich, denkwürdig, alltäglich, auch mal ironisch und künstlerisch. Lockdown Collection: Swiss FilmmakersMann mit Macken
FERNSEHEN: PROFESSOR T. Er ist eine wohltuend markante Ausnahmeerscheinung im Heer der Kommissare, Ermittlerinnen, Pathologen oder Assis am Bildschirm. Die letzte Staffel des eigenwilligen «Professor T.» ist gestartet (3. Folge am 26. Mai SRF 1, am 30. Mai ZDF). Smart, unnahbar, exzentrisch, auch unausstehlich, eitel und überheblich – Professor Jasper Thalmann lehrt Kriminologie und Kriminalpsychologie an der Universität Köln. Die erste Staffel spielte noch in Antwerpen, indes hat sich die Handlung nach Köln verlagert. In der aktuellen vierten Staffel (4 Folgen) wird Professor T. aus seinem Exil wieder an Tatorte am Rhein gelockt. Der Mann mit Macken leidet an einem Sauberkeitsfimmel, trägt blaue Handschuhe und lässt nicht berühren. Selbst seine Ex, die Kriminaldirektorin Christina Fehrmann (Julia Bremermann), kommt kaum an ihn heran. Aber der Sonderling ist ein genialer Seelenkenner und Ermittler der Marke Hercule Poirot. In der letzten Folge steht dann auch Christina im Brennpunkt, sie wird schwer verletzt, und Professor T. deckt ein schreckliches Geheimnis auf. Die Serie, seit 2017 produziert, ist eine Adaption der flämischen Reihe, die es bisher auf 39 Folgen gebracht hat. Nun soll die deutsche Reihe «Professor T.» nach 16 Episoden (Buch und Regie Thomas Jahn) beendet werden. Schade, denn Matthias Matschke alias Professor T. hat das Zeug zu einer Krimi-Kultfigur. TV-Serie, SRF 1 (dienstags) und ZDF (freitags)Beliebter Biedermann
FERNSEHEN: 100 JAHRE WALTER RODERER Er hätte in diesem Jahr am 3. Juli seinen 100. Geburtstag gefeiert, der «Mann mit der Melone», der schweizweit bekannte «Herr Nötzli». Der Volksschauspieler aus St. Gallen, Walter Roderer, hat sich als Biedermann mit dem langen Hals, als verkaufter Grossvater, Standesbeamter oder eben als Buchhalter Nötzli im Gedächtnis eingebrannt. Er starb 2012 in Illnau. Das Schweizer Fernsehen ehrt den pfiffigen Mimen mit einer breiten Werkschau. Sie beginnt am Samstag, 23. Mai, mit der Komödie «Der Herr mit der schwarzen Melone» (14,05 Uhr SRF 1), führt über den Klassiker «Der verkaufte Grossvater» (31. Mai, 13.10 Uhr, SRF 1) bis zum bekannten «Ein Schweizer namens Nötzli» (31. Mai, 20.40 Uhr, SRF 1). Eine Reportage schildert Walter Roderers letzte Monate: «Nötzlis Abgang» (30. Mai, 15.55 Uhr, SRF 1). Filmautor Felice Zenoni («Danioth – der Teufelsmaler», «Der Spitzel und die Chaoten») erinnert in seiner Dokumentation «Walter Roderer – Sie müend mi verstoh, gelled Sie!» an den beliebten Mimen (31. Mai, 20.05 Uhr, SRF 1). Freunde, Wegbegleiter kramen in Erinnerungen, markante Szenen sind wieder zu sehen: Der Schweizer Nötzli lebt auf! Und oben drauf kommt noch die Wiederausstrahlung eines Hörspielklassikers mit Ruedi Walter und Roderer: «Ein Schweizer in Paris» (1. Juni, 14.06 Uhr, Radio 1) Spezialsendungen SFR 1 vom 23. Mai bis 31. Mai 2020Tipps vom 11. Mai 2020
Unbändig
FILM – STREAMING: SYSTEMSPRENGER Die deutsche Überraschung des Kinojahrs 2019/20: Das Sozialdrama «Systemsprenger» von Nora Fingscheidt (Buch und Regie) packte Publikum wie Kritik, wurde im April mit acht «Lolas», dem Deutschen Filmpreis, ausgezeichnet (siehe Einblicke). Die neunjährige Bernadette «Benni» (Helena Zengel) ist ein Mädchen, das nicht nur aus dem Rahmen fällt, sondern auch gesellschaftliche Normen sprengt. Benni ist unbändig, ungezügelt, unangepasst, unberechenbar – voller Energie (auch mit Gewaltpotenzial) und von innerer Not. Mutter, Pflegeeltern, Pädagogen, Erzieher vom Jugendamt sind überfordert. Allein Micha (Albrecht Schuch), Boxfan und Anti-Aggressionstrainer, findet Zugang zum «wilden» Mädchen. Benni hängt sich an diesen neuen Freund, will ihn vereinnahmen, kommt seiner Familie (zu) nah.
Der impulsive, explosive Film über traumatische Erfahrungen, Verletztheit, Einsamkeit und emotionale Not zog bis Ende 2019 über 630'000 Besucher in Deutschland an. In der Schweiz startete «Systemsprenger» im Herbst. Streaming: Netflix, Google Play, Amazon Prime Video.
Am Rande
FILM – STREAMING: A TALE OF THREE SISTERS Drei Mädchen und ein Vater: In einem abgelegenen Dorf in Zentralanatolien hausen drei Mädchen mit ihrem Vater zusammen – mehr schlecht als recht. Die Töchter – Reyhan (29), Nurhan (16) und Nesthäkchen Havva (13) – wurden vom Vater nach dem Tode der Mutter als Dienstmädchen in die nächste Stadt geschickt und sind nun – aus unterschiedlichen Gründen – heimgekehrt. Jede hat Enttäuschungen erlebt. Reyhan, die älteste, diente dem Arzt Necati und wurde schwanger. In der Not wurde sie im Dorf mit dem Hirten Veysel verheiratet. Die jüngste Havva hatte den Platz ihrer Schwester bei den Necatis eingenommen, kam aber mit dem bettnässenden Sohn der Arztfamilie nicht klar. Die Dritte im Bunde, Teenager Nurhan, hatte als Kindermädchen ihren Schützling und damit ihren Job verloren. Drei junge Frauen, die ihren Weg, ihre Bestimmung, ihr kleines Glück suchen in einer von alten Männern bestimmten Welt. Der Vater Sevket, ein einfacher überforderter Mann, ist enttäuscht, hilflos. Auch der Hirte Veysel versucht seiner Bestimmung zu entgehen, bemüht sich, seiner Frau Reyhan zu helfen, dem scheinbar vorbestimmten Schicksal zu entkommen.
Der türkische Filmer Emin Alper beschreibt die Folgen der traditionellen «Besleme», der Fremdplatzierung von Kindern in der Türkei. Sein Spielfilm – halb Sozialdrama, halb Märchen – zeigt die Diskrepanz von Klassen, von Wünschen, Sehnsüchten und Wirklichkeiten. Die Launen des Schicksals spiegeln sich in den Launen und Gefühlen der Schwestern, eingebettet in majestätischen, auch schroffen Landschaftsbildern. Streaming: filmingo (Trigon Film)
Gescheitert
FILM – STREAMING: ALL MY LOVING All das, was wir lieben, geht flöten, könnte der Titel/Untertitel auch heissen. Doch er heisst schlicht: «Eine Geschichte von drei Geschwistern». Es gibt einen Prolog, einen Epilog und drei Kapitel. «Das wird schon wieder» muss sich Stefan (Lars Eidinger) von seiner Schwester Julia (Nele Mueller-Stöfen) sagen und trösten lassen, als er ihr gesteht, dass er wegen eines latenten Hörschadens seinen Job als Pilot verloren hat. Eben diese Schwester unternimmt mit ihrem Mann Christian (Godehard Giese) einen Italientrip (Turin und so). Doch anstatt die kriselnde Zweisamkeit zu beleben (das Paar verlor den Sohn), hat Julia nur noch einen Strassenköter im Sinn, den sie aufgelesen hat. «Inglaterra, ein Traum» ist das zweite Kapitel überschreiben. Tobi (Tobias) ist 39, noch immer Student und ein Mensch, der nichts geregelt kriegt. Tobi (Hans Löw) sollte sich um seine drei Kinder und seine Eltern kümmern, aber «Alles, was er anfasst», geht eben daneben. Die Mutter (Christine Schorn) will das Bad neu bestücken, und der Vater (Manfred Zapatka) ist nicht ganz bei Trost und verweigert jegliche Hilfe.
Der Episoden Film «All My Loving» von Edward Berger (Buch, Regie) und Nele Mueller-Stöfen (Buch) nimmt Alltagssituationen aufs Korn von Menschen, die sich verlieren und kein Ziel finden. Sie sind auf die eine oder andere Weise gescheitert, in ihrer Krise gefangen. Obwohl es zwischen den Geschwistern nur lose Berührungspunkte gibt, wirkt diese Bestandsaufnahme wie aus einem Guss, obwohl viele Aspekte offen bleiben und der Film ausläuft wie eine Welle am Strand. Streaming: Outside the Box via Partnerkinos
Gigantisch
FILM – STREAMING: THE GIANT Bisweilen ist es ein langer Weg von Schweden bis zu uns ins (Heim-)Kino. Johannes Nyholm realisierte seinen ersten Spielfilm (nach Trick- und Kurzfilmen) bereits 2016. «The Giant» (Jätten) – nicht zu verwechseln mit dem spanischen Film «Giant», 2017 – feierte in Toronto Premiere und kann jetzt bei uns eingesehen werden. Der Spielfilm mit märchenhaften Schlenkern erzählt vom 30jährigen Autisten Rikard (Christian Andrén). Der deformierte junge Mann kann sich nur vage verständigen, hat aber in einem schwedischen Boule-Club eine Heimat und in Roland (Johan Kylén) einen wahren Freund gefunden. Seine Mutter Elisabeth (Anna Bjelkerud) ist mit diesem Geschöpf überfordert und hat Rikard in ein Heim gegeben. Der träumt davon, seine Mutter zurückzugewinnen, indem er Nordischer Meister im Sand-Boulespiel (Pétanque) wird. Rikard und Roland bilden das Team Zughi BC und stossen tatsächlich ins Finale vor … Rikard, der von einigen despektierlich nur als Troll oder Gollum (die Missgestalt aus dem «Herrn der Ringe») beschimpft wird, sieht sich als Riese, der sich mit seiner Mutter zusammenführt.Die skandinavische Produktion «Jätten» (The Giant) ist eine melodramatische Phantasiegeschichte mit sehr realen Bezügen, die traurig und zugleich ein wenig Freude macht. Streaming: Outside the Box via Partnerkinos
Körperkult
FILM – STREAMING: MISHIMA Eine Wiederentdeckung. 1985 feierte das ausserordentliche Porträt «Mishima – A Life in Four Chapters» in Cannes Premiere und wurde für die beste Kameraarbeit John Baileys ausgezeichnet. Nun liegt es in restaurierter Fassung vor. Francis Ford Coppola und George Lucas hatten den Spielfilm produziert. Regisseur Paul Schrader schildert den letzten Tag im Leben des japanischen Schriftstellers und Künstlers Yukio Mishima, der am 25. November 1970 rituellen Selbstmord (Seppuku) beging. Er gilt als einer der bedeutendsten Poeten und Schriftsteller Japans im 20. Jahrhundert, er verfasste Gedichte, Erzählungen, Romane Schauspiele und ein Libretto. Schrader («Cat People», Drehbücher zu «Taxi Driver», «Raging Bull») bettet das Leben und Wirken Mishimas in eine Rahmenhandlung, beginnt mit der Vorbereitung des reaktionären Traditionalisten, der mit Mitgliedern seiner Privatarmee, einen Putschversuch unternimmt. Und endet damit, dass Mishima den Kaiser (Tenno) inthronisieren will, scheitert und traditionellen Seppuku (Selbstmord) begeht. In schwarzweissen Rückblenden wird das Leben Mishimas aufgeblättert, wobei die vier Kapitel «Schönheit», «Kunst», «Tat» sowie «Harmonie von Feder und Schwert» auch Begebenheiten und Figuren drei seiner Romane einbeziehen.Schraders Filmkunstwerk über 120 Minuten verwebt Biografisches mit Fiktionalem, Reales mit Künstlerischem. So werden die Hauptthemen Mishimas quasi belebt und in betörende Bilder umgesetzt: Körperkult und Narzissmus, Tabus und Sexualität (Homosexualität), politischen Aktivismus (Revolte und Restauration) und Tod (Harakiri). Streaming: ab 7. Mai filmingo (Trigon Film)
Zurück
Mai 2020
Kulturtipps
Auf Mexikos Strassen
FILM – STREAMING: MIDNIGHT FAMILY Sie jagen nachts durch die Strassen, wie von Furien gehetzt. Der 17jährige Juan lenkt den Wagen, Vater Fernando («Fer») Ochoa dirigiert und versucht den Fahrweg via Lautsprecher frei zu «schreien». Der jüngere mollige Bruder Josué ist Mitfahrer in diesem Rettungswagen. Er findet die nächtlichen Touren in Mexico City spannender und schwänzt die Schule. Das kleine Familienunternehmen ist auf der Jagd nach Patienten, Menschen, die verunfallt, geschlagen, angeschossen oder aus dem vierten Stockwerk gestürzt sind. Die Ochoas und andere sind Rettungsengel, die auch mal zu spät kommen, bisweilen keinen Pesos bekommen und oft von (korrupten) Polizisten behindert und erpresst werden. Familie Ochoa gehört in Mexico City zur Armada privater Rettungsambulanzen, die helfen, wo sie können. Unglaublich, aber wahr: In der mexikanischen Metropole mit neun Millionen Einwohnern sind ganze 45 (!) staatliche Rettungswagen im Einsatz. Der Amerikaner Luke Lorentzen (27) hat die «Midnight Family» Ochoa begleitet, war stiller Zeuge mit der Kamera, zeigt, wie sich das Trüppchen einsetzt, oft enttäuscht und abgezockt wird. Manchmal gibt's kleine Glücksmomente. Ein Dokumentarfilm, der sich jeden Kommentars enthält. Die Aktionen, die knappen Dialoge der Ochoas genügen. Die nächtlichen Touren sind oft spannender als manches Actionspektakel. Ein ungeschminkter gradliniger Film, der u.a. am Sundance Film Festival 2019 mit einem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet wurde.
«Midnight Family» kann man streamen, in einem Arthouse-Kino abrufen, beispielsweise beim Rex in Bern, Bourbaki in Luzern, KinoK in St. Gallen oder RiffRaff in Zürich. Kosten: 10 Franken, die Hälfte erhält das Kino der eigenen Wahl.
outside-thebox.ch oder myfilm.ch
BUCH: #CINEMA 65. SKANDAL Die unabhängige Schweizer Filmzeitschrift Cinema geht in den 65. Jahrgang. Die Broschüre, 215 Seiten stark (plus 16 Inseratsseiten) ist freilich kein Jahrbuch im herkömmlichen Sinn. Zwar werden in der Sélection Cinema (Schweizer Filmschaffen 2018–2019) auch 39 Filme besprochen (z.B. «Zwingli», «Der Büezer» oder «Baghdad in my Shadow»), doch das Hauptthema heisst «Skandal». Über ein Dutzend Beiträge angesehener Filmwissenschaftler und Kritiker kreisen mehr oder weniger um dieses Thema.
Interessant ist beispielsweise, wie Thomas Basgier, u. a. Gastdozent am Filmwissenschaftlichen Seminar der Uni Zürich, den Skandal-Bogen vom Schauspieler Roscoe «Fatty» Arbuckle 1921 zum Hollywood-Star Kevin Spacey und Produzent Harvey Weinstein heute schlägt, allesamt wegen Übergriffigkeit angeklagt und in Verruf gekommen. «Die türkische Sexploitationwelle 1974–1980)» beschreibt Aysel Özdilek (Uni Hamburg). Sie schreibt: «Die Vorstellung, dass die Tabuisierung und Stigmatisierung von sichtbarer weiblicher Sexualität ein überholtes Relikt aus den 1970er-Jahren ist, täuscht. Slutshaming angesichts freizügig bekleideter Frauen und vermehrte Vorfälle von Femiziden sind auch heute noch in einer von der islamisch-konservativen AKP-Partei regierten Türkei an der Tagesordnung.» Wieso Luis Buñuel und Salvador Dalí mit ihrem Film «L'âge d'or» 1930 für einen grossen Aufreger und Skandal der Filmgeschichte sorgten, beschreibt Christian Alexius in seinem Artikel «Angriff der Skorpione».
Aus Schweizer Sicht höchst spannend ist die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Fernsehfilms «Ursula» nach einer Geschichte aus Gottfried Kellers «Zürcher Novellen». Die Literaturverfilmung, eine Koproduktion zwischen dem Schweizer Fernsehen und der DDR 1978, inszenierte der DDR-Regisseur Egon Günther. Nach massiver Kritik im Westen wie im Osten beantragte Günther die Ausrede aus der DDR. Sie wurde ihm noch 1978 gewährt.
«Cinema #65.Skandal» bietet fundierten Lesestoff über auch über frühe Hollywoodfilme und ihre Regulierung, Gewaltfilme oder den Japaner Koji Wakamatsu 1965, das Enfant terrible des japanischen Kinos, und die Berlinale 1965. Ich persönlich freilich vermisse Beiträge über Ingmar Bergmans «Das Schweigen» (1963), das in meiner Jugend für Skandale sorgte, oder über Hildegard Knef und ihre Rolle als «Die Sünderin» (1951). Dienlich wäre es auch, wenn im Impressum der Redaktionsschluss der Ausgabe vermerkt würde.
«Cinema #65. Skandal». Unabhängige Schweizer Filmzeitschrift 65. Jahrgang, Schüren Verlag, Marburg 2020
Krimi um Mitternacht
FERNSEHEN: DEAD END In den Sechzigerjahren gab es einen Schlager, in dem Bill Ramsey die Binsenweisheit «Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett» verbreitet. Lächerlich? Nicht ganz. Krimis sind beliebt wie nie – in Büchern, Filmen, in Fernsehserien. Kein Vorabend ohne Krimi, keine Region ohne eigene Ermittler von Ost- und Nordsee bis Bayern und Bozen, von Mallorca («The Mallorca Files», ZFFneo, bieder und blond, Klischees en masse wie im Tourismusprospekt) bis Istanbul («Mordkommission Istanbul», ARD).
Die Krimiserie «Dead End» (6 Folgen) wurde 2019 bereits von ZDFneo ausgestrahlt, nun also im ZDF-Hauptprogramm. Eine interessante Konstellation: Die Pathologin Emma (Antje Traue) kehrt aus den USA heim in eine Kleinstadt im Brandenburgischen – zum 75. Geburtstag ihre Vaters Peter (Michael Gwisdek). Der werkelt als Leichenbeschauer und hat manchmal Leichen im Keller bzw. Knöchelchen im Kühlschrank in Folge 1 (17. April): «Mit den Cowboys kam das Verbrechen». Vater und Tochter spannen zusammen und ermitteln in einigen fragwürdigen Todesfällen. Der Bürgermeister (Fabian Busch) sabotiert, die junge Polizistin Bettin (Victoria Schulz) ist hilfreich und clever, der Lokalkommissar Schubert (Lars Rudolph) ein fauler Sack, und dann taucht FBI-Agent Dorsett (Nikolai Kinski, der Sohn des berühmt-berüchtigten Mimen), auf. Mal düster, mal skurril, mal geht es um ein «Schneewittchen» mit tödlichem Hustenanfall, um einen abgestürzten Gleitschirmflieger oder eine Greisin, die ihren 100.Geburtstag feiern will, aber…Der Alte, der Angst vor Demenz hat, und die naseweise, leicht überhebliche Tochter bilden ein Gespann, das übliche Krimiverhältnisse sprengt. Keine Sackgasse also, die Reihe hat Chancen, in eine zweite Staffel zu gehen. «Dead End», ab 17. April freitags jeweils um Mitternacht, ZDF. Weiter am 26. April, 1., 16. 23. und 30. Mai (ZDF, auch Mediathek) Weitere Krimi-Tipps: «Spreewaldkrimi: Zeit der Wölfe», 27. April, ZDF; «Nachtschicht: Cash & Carry», 4. Mai, ARD
Hitze – aussen und innen
Regisseurin Delphine Lehericey hat ein sensibles, stimmiges Familiendrama über Existenzängste, Familienrisse und erwachende Leidenschaften geschaffen. Sie schildert den Umbruch und Aufbruch der Protagonisten aus der Sicht des Teenagers Gus, der seinen Weg geht (bzw. auf dem Velo fährt). Im wahrsten Sinn des Wortes ein heisser Film, gedreht in Nordmazedonien. Er wurde als bester Schweizer Film 2020 ausgezeichnet, dazu gab's ausserdem einen Quartz für das beste Drehbuch. Im Januar lief er in den Deutschschweizer Kinos an, ziemlich erfolglos mit gut 1500 Zuschauern. In der Westschweiz hingingen verbuchte er bis zur Corona-Kinokrise 10 000 Besucher. Jetzt kann man den Film herunterladen bei einem Kino eigener Wahl, beispielsweise beim Kult.Kino Basel, Cameo Winterthur oder RiffRaff Zürich für 10 Franken. outside-thebox.ch
WEITERE KULTURTIPPS FÜR ZUHAUSE Auch wenn die neusten Bond- und Mulan-Abenteuer sowie «Black Widow» und andere Filme verschoben wurden, aktuelle Filme eingefroren wurden, kann Kino daheim stattfinden. Manche Produktionsgesellschaften bieten dazu Hand. Neben Netflix («Freud», jüngst vom ORF ausgestrahlt) gibt es Alternativen. Der Schweizer Spielfilm «Mare», die Rentner -Komödie «Cittadini del mondo» oder das schwedische Episoden-Puzzle «About Endlessness» sind auf der Online-Plattform von cinefile.ch bzw. myfilm.ch als Streaming zu sehen, ebenso der Dokumentarfilm über Bruno Manser von 2007 (Regie: Christoph Kühn), eine Wiederentdeckung.
Dschoint Ventschr offeriert als kleinen Trost Filme an, die man kostenlos daheim visionieren kann (Video on Demand): «Iraqui Odyssey» (2015) von Samir, «Verliebte Feinde» (2013, Bild) von Werner «Swiss» Schweizer, «Do It» (2000) von Sabine Gisiger und Marcel Zwingli sowie «Nachbeben» (2006) von Stina Werenfels. Neu hinzugekommen sind: «In wechselndem Gefälle» (Kurzfilm 1963 von
Alexander J. Seiler), «Motor Nash» (1996) von Sabine Gisiger und Marcel
Zwingli, «Opération Libertad» (2012) von Nicolas Wadimoff und «My
Father, the Revolution & Me» (2013) von Ufuk Emiroglu. Kostenlos beim Promocode «HomeCinema».
Samirs Spielfilm «Baghdad in My Shadow» ist als VoD bei cinefile.ch, myfilm.ch und filmingo.ch erhältlich.
Hunkeler kann's nicht lassen
Jeanne
FILM – STREAMING Bruno Dumont stellt die Nationalheilige Jeanne d'Arc ins Zentrum seines spröden stilisierten Films «Jeanne» – ohne Schlachtgetümmel und Brimborium. Keine andere Persönlichkeit, abgesehen vielleicht von Jesus, Napoleon und anderen Gestalten aus der antiken Mythologie, hat Filmemacher mehr inspiriert als die französische Nationalheroin Jeanne d'Arc. Die jüngste Version Bruno Dumonts folgt auf «Jeanette – Die Kindheit der Jeanne d'Arc», eine Art Musical von 2017. Nun hat er mit derselben Hauptdarstellerin Lise Leplat Prudhomme (12, Bild oben und unten) also nachgedoppelt.
Sein eigenwilliges, hoch stilisiertes Drama von 2019 ist statisch und schwerfällig, mit einigen Lieder aus dem Musical gespickt, die eher befremdlich wirken. «Jeanne» (siehe Filmkritik), die Jungfrau von Orleans, ist ein Teenager, der stoisch und sehr erwachsen seinen Leidensweg geht. Das Kind um 12 Jahre alt bietet den alten überheblichen Kirchenmännern Stirn. Der Spielfilm stellt den absolutistischen Anspruch einer Männerkirche an den Pranger, zeigt die Zerrissenheit einer gläubigen Seele, die sich nicht beugen und verbiegen lässt. Sie, von göttlicher Botschaft besessen, unterliegt kirchlichen Machtdünkeln. Den Film kann man fürs Heimkino (Streaming) abberufen und so Kinos der eigenen Wahl unterstützen. outside-thebox.ch
Mittelalter
FERNSEHEN Die ZDF-Dokureihe Terra-X von Mirko Drotschmann taucht in 1000 Jahre Geschichte – von 500 bis 1500 n.Chr., das heisst vom Ende des Römischen Reiches bis zur Erfindung des Buchdrucks. In der «Kurzen Geschichte … übers Mittelalter» schildern Historiker, wie gewaltige Kathedralen entstehen, Burgen das Land überziehen (30 000 in Deutschland), Städte wachsen, Gilden gegründet werden, wie Ritter, eigentlich Pferdemänner, Teil des niederen Adels, aufsteigen, und wie das Lehnswesen funktioniert (Teil 1). Drotschmann zeigt aber auch, dass Frauen mehr drauf hatten, als als Burgfräulein besungen zu werden. In einem weiteren Kapitel widmet er sich der Hexenverfolgung (5. April). Bis 1780 fielen rund 50 000 Menschen diesem religiösen Wahnsinn zum Opfer in Europa, Jeanne d'Arc inbegriffen. Was geschah in den Folterkammern, weshalb wurden besonders Frauen Opfer dieses Hexenwahns? In einem dritten Beitrag der Reihe «Eine kurze Geschichte über…» geht es um das Alte Ägypten (14. April). Terra-X (sonntags 19.30 Uhr oder ZDFmediathek).
BUCH «Trotz alledem. Mein Leben» – so lautet der Titel der Biographie des Liedermachers Hannes Wader. Auf rund 580 Seiten plus Zeittafel und Diskografie beschreibt der Komponist, Liedermacher und Barde sein Vagantenleben zwischen Bethel bei Bielefeld, seinem Geburtsort 1942, und Kassel, seinem momentanen Wohnsitz. «Und ich denke beim Schreiben die ganze Zeit, ich habe mein gelebtes Leben vor Augen – dabei ist es immer nur der Tod. Was bleibt mir da anderes übrig, als einfach weiterzumache? Ich beende das letzte Kapitel – mal sehen, was dann passiert.» Seine Lieder wie «Der Rattenfänger», «Kokain», «Heute hier morgen dort» oder «Ich hatte mir noch so viel vorgenommen» sind unvergänglich wie der Barde mit der Gitarre selber, der im November 2017 sein letztes Konzert gab. Ein Lied hat ihn jahrzehntelang begleitet und wurde zu einer Art Bekenntnis: «Trotz alledem» (siehe Buchtitel).
Seine sehr persönliche Biographie liest sich wie eine Zeitgeschichtslektüre, etwa über Festnahme und Verhöre 1971 wegen Beteiligung einer kriminellen Vereinigung. Hannes Wader hatte der vermeintlichen Journalistin Hella Utesch seine Wohnung in Hamburg überlassen, während er durch Europa tourte. Die gewisse Hella war die Terroristin Gudrun Esslin (RAF). Wader wurde falsch beschuldigt, observiert, von Konzertveranstaltern boykottiert, obwohl man ihm nichts nachweisen konnte. Sein Liedermacherfreund Reinhard Mey und andere Kollegen haben sich für den Vorverurteilten eingesetzt, Konzerte erzwungen. Wader wurde immer wieder verdächtigt, beschattet und verhört wird. «Eine schier endlose Geschichte», zieht Wader Bilanz. Natürlich beschreibt er auch seine Auftritte und Begegnungen in der Schweiz mit Bernhard Stirnemann und seinen Berner Troubadours, mit Emil und Mani Matter oder Franz Hohler. Hannes (eigentlich Hans Eckard) ist ein politischer Mensch (DKP) und Poet, Volkssänger und Barde, der 2013 die Auszeichnung Echo für sein Lebenswerk bekam. «Übrigens», stellt Wader klar, «2013 kann ich den Echo noch mit Freude annehmen. Zu dieser Zeit gilt der in Deutschland wichtigste Musikpreis noch nicht als desavouiert und entwertet.» Ein Buch so reich wie das Liedergut Hannes Waders, der sich hier mit der Bildlegende «Macht's gut.» verabschiedete. Hannes Wader: «Trotz alledem. Mein Leben», mit zahlreichen Abbildungen im Penguin Verlag, 2. Auflage 2019, München
FILM – STREAMING Er ist Choreograph, sie seine Tänzerin, Geliebte, Widerpart. Ema und Gastón bilden ein wildes Paar, das den Reggaeton, einen poppigen Musikstil, bis zum Exzess lebt. Der Chilene Pablo Larraín schuf ein ekstatisches Drama über Kunst, Liebe, Lust und Leidenschaft, dessen Bilder haften bleiben (siehe Filmkritik). Trigon Film bietet den exaltierten Tanz- und Liebesfilm auf seinem Streaming-Dienst filmingo.ch an (ausgewählte Arthouse-Filme für 9 Franken für 2 Filme).
Dunkelstadt
FERNSEHEN Sie ist anders als manche Schnüffler, die man aus deutschen Serien kennt und hat mit Matula (Claus Theo Gärtner in «Ein Fall für zwei»), dem Methusalem unter den TV-Detektiven, wenig am Hut. Doro Decker (Bild) hat ihren Vater verloren – er kam als Polizist bei einer Personalkontrolle ums Leben. Sie hat selber den Polizeidienst quittiert und wurschtelt als Privatdetektivin durchs Leben – in Dunkelstadt (Drehort Antwerpen). Doro bevorzugt Whisky und Alleingänge. Sie ist tough (gleichzeitig apart hübsch), raucht wie ein Schlot und muss viel einstecken. Ihr zur Seite stehen Assi Adnan (Rauand Taleb), ein vifer flatterhafter Paradiesvogel, und Kommissar Chris (Artjom Gilz). «Diese Stadt», sinniert Doro Decker, die gern sich selbst kommentiert, «zieht verlorene Seelen an wie das Licht die Motten – auf der Suche nach Nähe, Wärme oder einfach einer schnellen Nummer – kommt sie aus den Löchern gekrochen. Diese Stadt hat jede Menge Liebe zu geben, aber umsonst ist sie nicht.»
Die Serie «Dunkelstadt» im Film Noir-Stil sticht aus allen deutschen Krimiserien heraus – mit Alina Levshin in der Hauptrolle, die ihre eigenen Macken und Ausstrahlung hat. Die 1. Staffel ist auf sechs Folgen ausgelegt: «Traumfänger» (Folge 5) ausgestrahlt am 28. März (ZDF) oder «Schafspelz» (6) am 1. April (ZDFneo) oder 4. April (ZDF, alle Folgen auf ZDF Mediathek).
Ballhaus
BUCH Berlin ist «in», besonders in den Roaring Twenties, den wilden Zwanzigerjahren. Die TV-Reihe «Berlin Babylon» mag dazu beigetragen haben. Susanna Goga hat ihre Krimireihe in eben dieser Zeit und in dieser pulsierenden Stadt angesiedelt. Kommissar Leo Wechsler ermittelt – mal in Clärchens Ballhaus (das gibt's wirklich), mal im Cabaret des Bösen, einem Sensationstheater. Wie im Roman «Nachts am Askanischen Platz» (2018) wird auch im jüngsten Fall «Der Ballhausmörder» (2020, der siebte Band) wird eine Leiche in einem Hinterhof gefunden. Leo Wechsler macht sich auf die Suche in einer schummrigen Welt zwischen Amüsement und Tristesse, Theater, Sekt und Charleston. «Ich möchte das Weimarer Berlin in seiner ganzen Vielfalt zeigen, nicht nur den Tanz auf dem Vulkan oder die Goldenen Zwanziger, die nie so richtig golden waren», bemerkt die Autorin Susanne Goga (Bild), die in Mönchengladbach lebt. Alle Krimis in der dtv Verlagsgesellschaft, München.
Auf seine Art begleiten Wim Wenders und sein Team das Kirchenoberhaupt auf den Wegen zu den Armen, etwa in die Favelas Rio de Janeiros oder nach Peru, zu Strafgefangenen in Neapel, zu Spitälern, zu Opfern des Taifuns auf den Philippinen, zu den Flüchtlingen in Lesbos und Lampedusa oder zu den Politikern, beispielsweise im US-Kongress oder bei einer UN-Vollversammlung. Wim Wenders nimmt den Papst beim Wort, illustriert seine Worte mit Bildern und Taten. Das Anliegen des Franziskus wird zu Wenders' Anliegen. Über mehrere Tage hat der Filmer Franziskus interviewt (ohne selber in Erscheinung zu treten) und offene Antworten erhalten, die Wenders dann geschickt durch Aufnahmen der Papstauftritte und -reisen dokumentiert.
Wenders’ Begegnungen mit dem Papst – von Angesicht zu Angesicht sozusagen – spiegeln nicht nur die Mission eines charismatischen Mannes wider, sondern auch unsere Welt, ihre Nöte, Probleme, Sünden. Der Film «Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes» wird am Karfreitag vom ZDF ausgestrahlt (22.50 Uhr).
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch der Spielfilm «Two Popes – Zwei Päpste» (Netflix, 2019; siehe Filmkritik) mit Jonathan Pryce und Anthony Hopkins, basierend auf dem Buch (Diogenes Verlag) von Anthony McCarten. Eine fundierte spannende Darstellung des Papst-Clinches zwischen Vorgänger Kardinal Joseph Ratzinger (Papst Benedikt) und Nachfolger Jorge Mario Bergoglio (Papst Franziskus).
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.
H1 Überschrift
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.