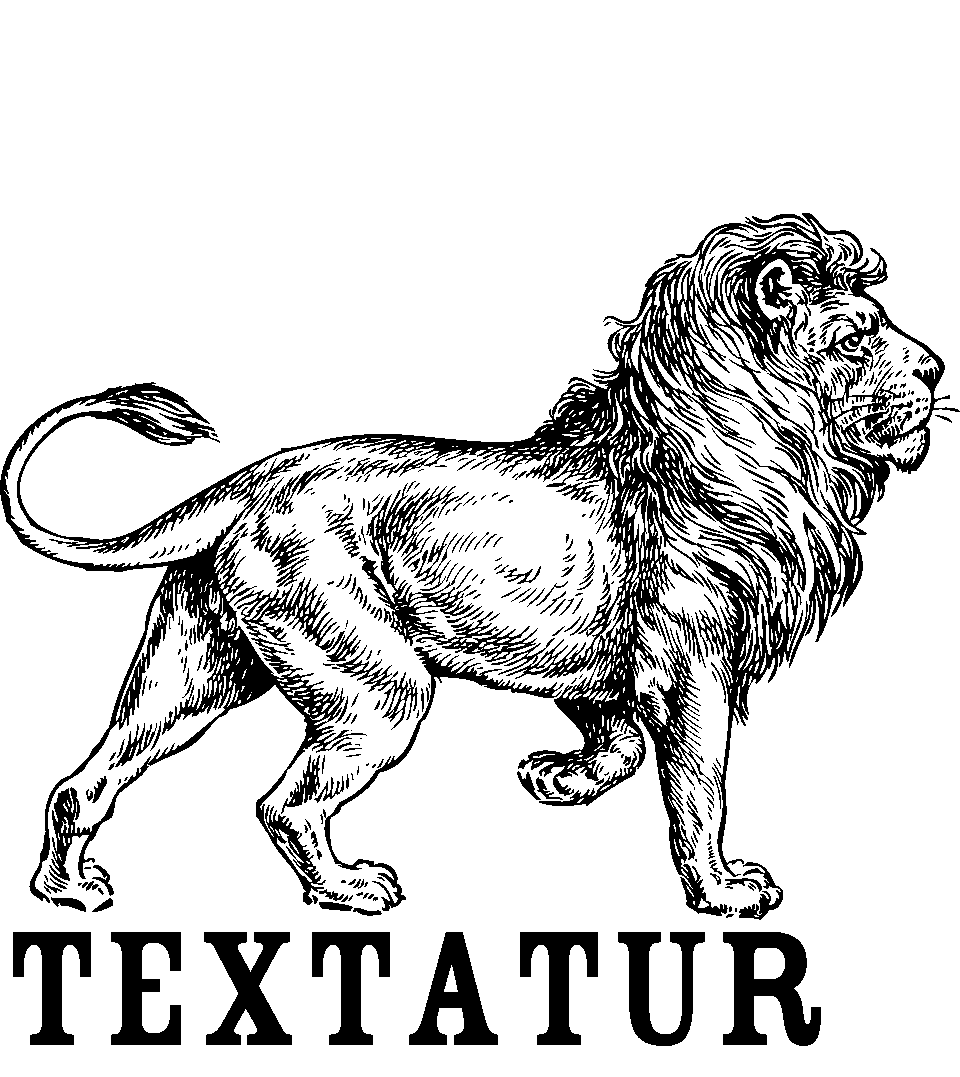Eine Doppelrolle, die herausforderte
Ein Leben mit Handicaps: Die Basler Filmerin Fanny Bräuning (43) hat ihre Eltern auf Camperreisen im Mittelmeerraum begleitet. Ein schwieriges Unterfangen, denn ihre Mutter Annette (70) ist seit Jahrzehnten vom Hals abwärts gelähmt und ihre Vater Niggi (71) Mädchen für alles – Fahrer, Tüftler, Fotograf, Pfleger und fürsorglicher Ehemann. «Immer und ewig» – ein sehr persönlicher Film, Roadmovie, Dokument zweier Leben und einer Liebe. Er wurde in Solothurn mit dem Prix de Soleure ausgezeichnet, dotiert mit 60 000 Franken.
Siehe Filmkritik «Immer und ewig».
Beide Protagonisten waren an der Schweizer Premiere des Films «Immer und ewig» an den Solothuner Filmtagen präsent und freuten sich still über die Aufmerksamkeit und den Beifall des Publikums. Wir trafen die Filmautorin Fanny Bräuning, die einen zwanzigjährigen Sohn hat und seit 14 Jahren in Berlin lebt. Sie erzählte von ihrer Arbeit mit ihren Eltern, beschrieb ihre Doppelrolle als Tochter und Filmerin.
Du hast deine Eltern auf mehreren Reisen begleitet und diese Eindrücke zu einem Film zusammengefügt. Unter anderem fällt auf, mit welcher Leidenschaft dein Vater mit der Kamera unterwegs ist. Was treibt ihn?
Fanny Bräuning: Er verwertet die Bilder nicht professionell, er hat einfach Freude am Gucken, ausserdem fotografiert er für meine Mutter, um ihr zu zeigen, was sie nicht sehen konnte. Seine Kamera dokumentiert, was er für sich entdeckt hat, und wird zum verdichteten Blick, der schöne lebenswerte Dinge festhält.
Deine Ambition ist doch auch das Einfangen von Momenten…
Ja schon. Aber ich muss dabei dramaturgisch denken und mich fragen, wie kann dieser Moment Teil der Geschichte sein.
Ist das alles spontan entstanden, oder gab es ein Konzept, ein Drehbuch?
Man muss, um Geld zu bekommen, ein Buch vorlegen. Ausserdem bin ich drei Wochen mit ihnen gefahren – mit der Kamera, die mehr als Notizbuch diente, quasi als Recherche.
Und da boten sich Fixpunkte an…?
Es gibt Rituale, die immer gleich ablaufen wie das Anziehen, der Transfer in den Rollstuhl, und anderes. Bei anderen Szenen waren wir natürlich stark vom Zufall abhängig. Und ich wollte natürlich auch Gespräche einbauen. Der Camper wirkt als verdichteter Raum wie in einem Kammerspiel und gleichzeitig ist der Film ein Roadmovie geworden.
In den Gesprächen wird auch die Frage nach Opfer und Hingabe gestellt? Wie empfindest du diese Aspekte?
Mein Vater hat vieles aufgegeben, eben auch seine Karriere als Fotograf. Er selber sieht das aber nicht als Opfer. Das fand ich spannend.
Für mich annonciert der Titel «Immer und ewig» auch, dass es um Liebe geht. Siehst du das auch so?
Für mich ist es ein Liebesfilm, zwischen den beiden, aber auch über die Liebe zum Leben: Wo findet sinnvolles Leben statt, worin kann man auch Erfüllung finden? Für mich hat der Titel auch eine gewisse Brüchigkeit. Etwa in diesem Sinn: Ich kenne meine Mutter schon ewig mit Handicap, also zuerst am Krückstock, dann im Rollstuhl.
Was hält sie, was hält beide am Leben?
Es ist sicher auch die Beziehung, meine Mutter ist nicht allein. Und ich denke allgemein die Grundhaltung von beiden, sich nicht zu bemitleiden, sondern das Beste aus ihrem Leben zu machen.
Wie bist du mit deiner Doppelrolle klargekommen?
Da waren verschiedene Fragen zu lösen wie beispielsweise: Wie wird die Tochter spürbar, wie äussert sie sich? Ich musste als Erzählerin vorkommen und wollte gleichzeitig die Kamera sein, sie sollte mein Blick sein. Ich komme selten vor die Kamera, nur wenn meine Mutter mich ruft und Hilfe braucht oder mein Vater mich holt. Diese Doppelrolle war herausfordernder, als ich gedacht habe. Es ist ja schon anstrengend, Regie zu führen, und dazu noch Tochter sein… Man bleibt ja immer das Kind seiner Eltern.
Wie hast du die emotionellen und existentiellen Fragen geplant, umgesetzt?
Viele der Fragen hatte ich von Anfang an. Bei der Frage «Vermisst du deinen Beruf als Fotograf?» beispielsweise habe ich nach einem szenischen Moment gesucht, wo er in seinem Element und ganz Fotograf ist. Das war dann der Fall bei dem Castell, wo mein Vater nach dem richtigen Licht sucht. Da habe ich seine Arbeit und seinen Verzicht angesprochen. Dann gibt es Gespräche in Interviewsituationen, wo ich Verschiedenes anspreche.
Eine entscheidende Situation für mich ist, als dein Vater sagte: Ich kann nicht anders, ich mache keine halbherzigen Sachen. Er geht aufs Ganze.
Ja, für ihn war die Entscheidung ganz klar. Beides: Fotograf sein und meine Mutter pflegen, geht nicht. Also hat er seinen geliebten Beruf aufgegeben. Aber er liebt es immer noch, auf ihren Reisen zu fotografieren. Meine Mutter sagt, er sei immer noch Fotograf... Dieser Teil seiner Identität ist ja nicht gestorben. Er ist immer noch er.
Wunderbar sind die Zeichnungen deiner Mutter, die du anfangs zeigt: Eine Frau, die immer weniger wird. Was hat es damit für eine Bewandtnis?
Es entstand ein Jahr vor meiner Geburt, also 1974. Da wusste sie nicht, dass sie MS hat. In dieser Reihe einer Frauenfigur bleiben am Ende ein Kopf, eine Explosion und eine Wolke. Heute fühlt es sich wie eine Prophezeiung an.
Haben diese Zeichnungen einen Titel?
Meine Mutter war Grafikerin und sagt, das Bild hätte keinen Titel. Für mich ist es «Die verschwindende Frau».
Wie haben deine Eltern den Film aufgenommen?
Beide waren ja auch bei der Premiere in Leipzig dabei. Sie wurden gefeiert und auf der Strasse angesprochen. Meiner Mutter hat der Film gefallen, meinem Vater auch. Doch der Fotograf hätte gern dieses oder jenes im Film gehabt, etwas, was ihm wichtig erschien. Er hätte sicher einen anderen Film gedreht.
Ist die Reiselust deiner Eltern nach wie vor ungebrochen?
Ja, im letzten Jahr waren sie im Frühling sechs Wochen in Tunesien, im Sommer in Wales und im Herbst wieder auf griechischen Inseln. Sie sind unterwegs, solange es geht. Sie haben auch in Solothurn in ihrem Camper gewohnt.
Zurück
Veröffentlicht Februar 2019
Siehe Filmkritik «Immer und ewig».
Beide Protagonisten waren an der Schweizer Premiere des Films «Immer und ewig» an den Solothuner Filmtagen präsent und freuten sich still über die Aufmerksamkeit und den Beifall des Publikums. Wir trafen die Filmautorin Fanny Bräuning, die einen zwanzigjährigen Sohn hat und seit 14 Jahren in Berlin lebt. Sie erzählte von ihrer Arbeit mit ihren Eltern, beschrieb ihre Doppelrolle als Tochter und Filmerin.
Du hast deine Eltern auf mehreren Reisen begleitet und diese Eindrücke zu einem Film zusammengefügt. Unter anderem fällt auf, mit welcher Leidenschaft dein Vater mit der Kamera unterwegs ist. Was treibt ihn?
Fanny Bräuning: Er verwertet die Bilder nicht professionell, er hat einfach Freude am Gucken, ausserdem fotografiert er für meine Mutter, um ihr zu zeigen, was sie nicht sehen konnte. Seine Kamera dokumentiert, was er für sich entdeckt hat, und wird zum verdichteten Blick, der schöne lebenswerte Dinge festhält.
Deine Ambition ist doch auch das Einfangen von Momenten…
Ja schon. Aber ich muss dabei dramaturgisch denken und mich fragen, wie kann dieser Moment Teil der Geschichte sein.
Ist das alles spontan entstanden, oder gab es ein Konzept, ein Drehbuch?
Man muss, um Geld zu bekommen, ein Buch vorlegen. Ausserdem bin ich drei Wochen mit ihnen gefahren – mit der Kamera, die mehr als Notizbuch diente, quasi als Recherche.
Und da boten sich Fixpunkte an…?
Es gibt Rituale, die immer gleich ablaufen wie das Anziehen, der Transfer in den Rollstuhl, und anderes. Bei anderen Szenen waren wir natürlich stark vom Zufall abhängig. Und ich wollte natürlich auch Gespräche einbauen. Der Camper wirkt als verdichteter Raum wie in einem Kammerspiel und gleichzeitig ist der Film ein Roadmovie geworden.
In den Gesprächen wird auch die Frage nach Opfer und Hingabe gestellt? Wie empfindest du diese Aspekte?
Mein Vater hat vieles aufgegeben, eben auch seine Karriere als Fotograf. Er selber sieht das aber nicht als Opfer. Das fand ich spannend.
Für mich annonciert der Titel «Immer und ewig» auch, dass es um Liebe geht. Siehst du das auch so?
Für mich ist es ein Liebesfilm, zwischen den beiden, aber auch über die Liebe zum Leben: Wo findet sinnvolles Leben statt, worin kann man auch Erfüllung finden? Für mich hat der Titel auch eine gewisse Brüchigkeit. Etwa in diesem Sinn: Ich kenne meine Mutter schon ewig mit Handicap, also zuerst am Krückstock, dann im Rollstuhl.
Was hält sie, was hält beide am Leben?
Es ist sicher auch die Beziehung, meine Mutter ist nicht allein. Und ich denke allgemein die Grundhaltung von beiden, sich nicht zu bemitleiden, sondern das Beste aus ihrem Leben zu machen.
Wie bist du mit deiner Doppelrolle klargekommen?
Da waren verschiedene Fragen zu lösen wie beispielsweise: Wie wird die Tochter spürbar, wie äussert sie sich? Ich musste als Erzählerin vorkommen und wollte gleichzeitig die Kamera sein, sie sollte mein Blick sein. Ich komme selten vor die Kamera, nur wenn meine Mutter mich ruft und Hilfe braucht oder mein Vater mich holt. Diese Doppelrolle war herausfordernder, als ich gedacht habe. Es ist ja schon anstrengend, Regie zu führen, und dazu noch Tochter sein… Man bleibt ja immer das Kind seiner Eltern.
Wie hast du die emotionellen und existentiellen Fragen geplant, umgesetzt?
Viele der Fragen hatte ich von Anfang an. Bei der Frage «Vermisst du deinen Beruf als Fotograf?» beispielsweise habe ich nach einem szenischen Moment gesucht, wo er in seinem Element und ganz Fotograf ist. Das war dann der Fall bei dem Castell, wo mein Vater nach dem richtigen Licht sucht. Da habe ich seine Arbeit und seinen Verzicht angesprochen. Dann gibt es Gespräche in Interviewsituationen, wo ich Verschiedenes anspreche.
Eine entscheidende Situation für mich ist, als dein Vater sagte: Ich kann nicht anders, ich mache keine halbherzigen Sachen. Er geht aufs Ganze.
Ja, für ihn war die Entscheidung ganz klar. Beides: Fotograf sein und meine Mutter pflegen, geht nicht. Also hat er seinen geliebten Beruf aufgegeben. Aber er liebt es immer noch, auf ihren Reisen zu fotografieren. Meine Mutter sagt, er sei immer noch Fotograf... Dieser Teil seiner Identität ist ja nicht gestorben. Er ist immer noch er.
Wunderbar sind die Zeichnungen deiner Mutter, die du anfangs zeigt: Eine Frau, die immer weniger wird. Was hat es damit für eine Bewandtnis?
Es entstand ein Jahr vor meiner Geburt, also 1974. Da wusste sie nicht, dass sie MS hat. In dieser Reihe einer Frauenfigur bleiben am Ende ein Kopf, eine Explosion und eine Wolke. Heute fühlt es sich wie eine Prophezeiung an.
Haben diese Zeichnungen einen Titel?
Meine Mutter war Grafikerin und sagt, das Bild hätte keinen Titel. Für mich ist es «Die verschwindende Frau».
Wie haben deine Eltern den Film aufgenommen?
Beide waren ja auch bei der Premiere in Leipzig dabei. Sie wurden gefeiert und auf der Strasse angesprochen. Meiner Mutter hat der Film gefallen, meinem Vater auch. Doch der Fotograf hätte gern dieses oder jenes im Film gehabt, etwas, was ihm wichtig erschien. Er hätte sicher einen anderen Film gedreht.
Ist die Reiselust deiner Eltern nach wie vor ungebrochen?
Ja, im letzten Jahr waren sie im Frühling sechs Wochen in Tunesien, im Sommer in Wales und im Herbst wieder auf griechischen Inseln. Sie sind unterwegs, solange es geht. Sie haben auch in Solothurn in ihrem Camper gewohnt.
Zurück
Veröffentlicht Februar 2019