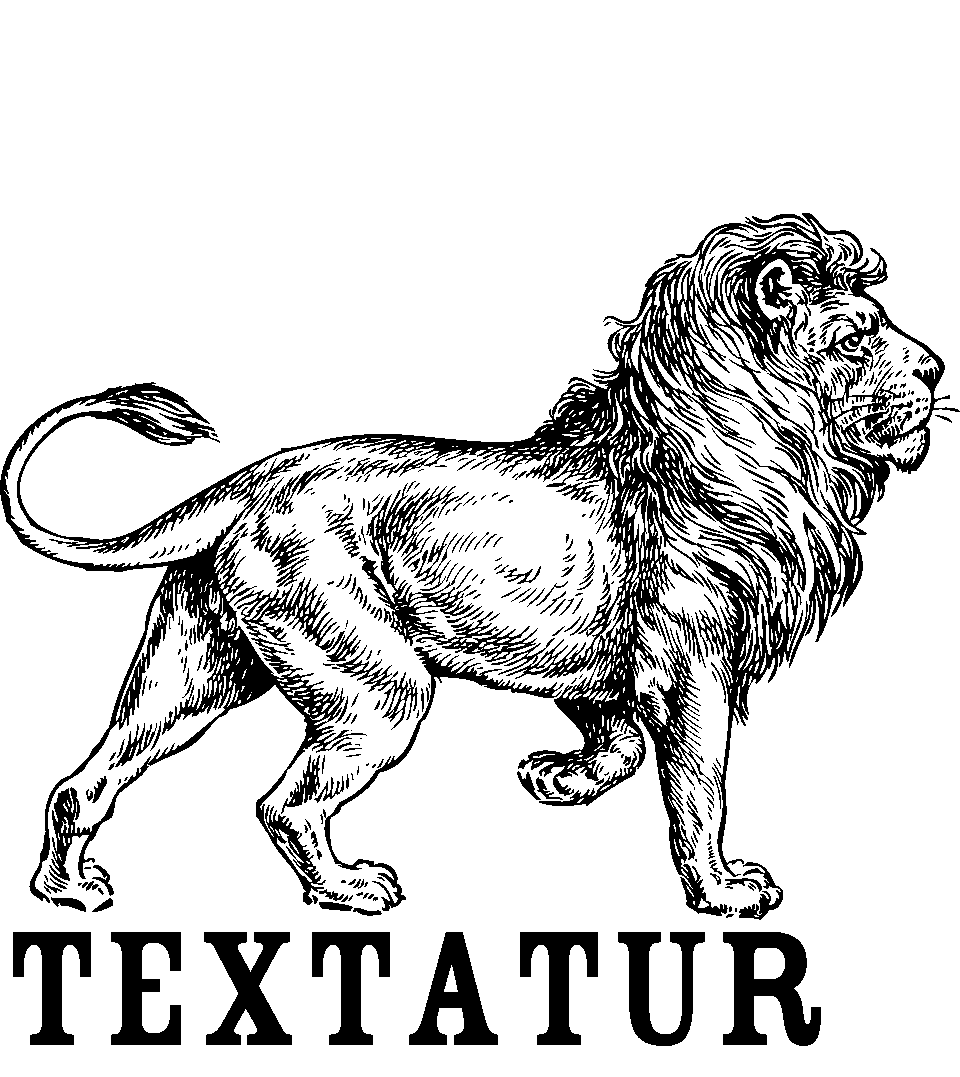Exzentrisch, theatralisch, faszinierend: Rockperformer Freddie Mercury elektrisierte das Publikum und nervte die Band. (Warner Bros.)
Freddie Forever
Er starb 1991 und scheint unsterblich, was die Musik von Queen angeht. Freddie Mercury, charismatischer Leadsänger, war die Gallionsfigur einer Band, die zum Kult wurde. Das zeigte sich erst jüngst bei der SWR-Hitparade 2018, bei der über 1000 Titel in fünf Tagen über den Äther gingen. Bei diesjährigen Hörerabstimmung in Baden-Württemberg löste Queen mit «Bohemian Rhapsody» den jahrelangen Spitzenreiter Led Zeppelin ab. Der Kultsong landete auf Platz eins und gibt dem Spielfilm von Bryan Singer den Titel. Und der fokussiert sich vor allem auf den exzentrischen Band-Leitwolf Freddie Mercury, der sich selbst zur Kultfigur stilisierte – exzentrisch, exaltiert, exorbitant.
Das Mercury-Kino-Biopic beginnt mit den Vorbereitungen der Band ins Wembley Stadion 1985 und endet mit dem mitreissenden Auftritt von Freddie und Queen-Kumpanen bei diesem legendären «Live Aid»-Konzert, organisiert von Bob Geldof.
Ursprünglich hiess der Sänger Farrah Bulsara, ein Immigrant mit indischen Wurzeln (Parsen/Perser), 1946 in Sansibar geboren, der mit Familie ab 1964 in London heimisch wurde. Nach verschiedenen Band-Beteiligungen gründete er 1970 Queen – mit Brian May (Gitarre) und Roger Taylor (Drums), Bassist John Deacon kam 1971 hinzu. Freddie nannte sich seitdem Mercury, wahrscheinlich in Anlehnung an den römischen Merkur, Götterbote sowie Gott der Händler und Diebe.
Von der Bandgründung – Freddie erschien den Musikern wie eine Fata Morgana, sang vor und wurde zum Leader – bis zum Wembley-Grossereignis 1985 spannt sich der dramatische Bogen des Spielfilms, der eine lange Entstehungsgeschichte über zwölf Jahre hinter sich hat. May und Taylor kündigten bereits 2006 eine Verfilmung an. Regisseur Bryan Sing («X-Men»), der immer mal wieder verschwand, wurde kurz vor Drehende gefeuert, Dexter Fletcher vollendete. Im Gespräch als Mercury-Darsteller waren Johnny Depp und Sacha Baron Cohen. Schliesslich übernahm der Amerikaner mit ägyptischen Wurzeln, Rami Malek, den Part. Er hatte sich akribisch auf diese Rolle vorbereitet. Tatsächlich, seine Darstellung mit Hasen-Schneidezähnen und Schnauz ist phänomenal, er fasziniert von der Körperhaltung bis zum Gesang (teilweise ist Maleks Stimme bei den Songs zu hören). Oscarwürdig.
Auch wenn die Mitstreiter der Band zu oft in den Hintergrund gedrängt werden und teilweise nur Kulisse bieten – Ben Hardy als Taylor, Gwilym Lee als May, Joseph Mazzello als Deacon und Lucy Boynton als Mary – tragen sie erheblich zur hinreissende Mercury-Hommage bei. Vieles klammert der «Bohemian»-Film aus. Freddies frühe Jahre werden nur angedeutet, sein Verhältnis zur Familie verkommt zum emotionalen Clinch, die Bandmitglieder bleiben Staffage und haben kein Eigenleben, kein Charakter. Freddies Liebe zu Mary ist nur ein Herz-Schmerz-Nebenkapitel. Freddies Aids-Erkrankung dient als dramatische Episode, die übrigens erst nach dem «Live Aid» erkannt wurde. Kurzum, der Spielfilm bietet wenig Tiefe, dafür aber desto mehr Glimmer und Emotionen (gegen Schluss).
Spannend nicht nur für Queen-Fans sind die Werk-Passagen, in denen die Entstehung etwa des sinfonischen Sechsminuten-Klassikers «Bohemian Rhapsody» geschildert wird. Über weite Strecken ist das Pop-Drama plakativ, klischeehaft und oberflächlich, wird zur bunten Zeitreise und visuellen Hommage an eine exzentrische Pop-Persönlichkeit. Doch der Musikfilm packt und sorgt für Pathos pur, besonders beim Finale mit dem Wembley-Höhepunkt. Da bleibt kein Auge trocken!

USA/GB 2018
135 Minuten
Regie: Bryan Singer, Dexter Fletcher
Buch: Anthony McCarten, Peter Morgan
Kamera: Newton Thomas Sigel
Darsteller: Rami Malek, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Allen Leech, Lucy Boyton
Zurück